Ein Kind auf dem Weg zum Zoo möchte einer Ameise zuschauen, die eine Tannennadel über einen Grasbüschel schleppt. Der Vater steht ungeduldig daneben und sagt: „Heute schauen wir nicht Ameisen, sondern Zebras.“
Peter Sutter, 9. Mai 2025
Ein Kind auf dem Weg zum Zoo möchte einer Ameise zuschauen, die eine Tannennadel über einen Grasbüschel schleppt. Der Vater steht ungeduldig daneben und sagt: „Heute schauen wir nicht Ameisen, sondern Zebras.“
Peter Sutter, 9. Mai 2025
Peter Sutter, 7. Mai 2024
Eine ganze Generation verliere ihre Zuversicht, lese ich im „Tagesanzeiger“ vom 6. Mai 2025. Dies vor allem wegen der schrumpfenden „Lebenszeit“ bei gleichzeitig immer weiter wachsender „Bildschirmzeit“.
Doch macht man es sich wohl zu einfach, die Schuld vor allem bei den sozialen Medien zu sehen, welche die Jugendlichen davon abhielten, Lebensfreude in der „realen Welt“ zu finden. Denn das eigentliche Hauptproblem sind nicht die sozialen Medien, sondern vielmehr diese sogenannte „reale Welt“. Diese ist nämlich alles andere als eine Quelle echter Lebensfreude, sondern mittlerweile dermassen stark von übermässigem Leistungsdruck und einem immer härteren gegenseitigen Konkurrenzkampf geprägt, während Lebensfreude und Lebensgenuss sowie Wertschätzung, Anerkennung und Ermutigung, ohne die ein junger Mensch seine Persönlichkeit und seine individuellen Begabungen nicht wirklich erfolgreich entfalten kann, immer mehr auf der Strecke bleiben.
Die sozialen Medien sind leider für viele fast noch der einzige Ort, wo sie schöne, spannende und fröhliche Dinge jenseits von Leistungsdruck, zwischenmenschlicher Kälte und Fremdbestimmung erleben können. Es ist nicht die „Bildschirmzeit“, welche sich auf Kosten der „Lebenszeit“ immer weiter ausbreitet, sondern genau umgekehrt: Die „Bildschirmzeit“ breitet sich gerade deshalb immer weiter aus, weil die „Lebenszeit“ für lebenshungrige, entdeckungsfreudige, abenteuerlustige und nach persönlicher Selbstverwirklichung strebende junge Menschen immer mehr an Attraktivität verliert.
Würde man die „Bildschirmzeit“ künstlich einschränken oder gar – zum Beispiel durch Handyverbote an den Schulen – geradezu verbieten, nähme man den Jugendlichen ausgerechnet auch noch das Letzte weg, was ihr Leben ein wenig spannender und abwechslungsreicher zu gestalten vermag. Wer die „Bildschirmzeit“ ernsthaft reduzieren möchte, müsste daher konsequenterweise alles daran setzen, den gesellschaftlichen, sozialen und beruflichen Alltag so attraktiv, freudvoll, humorvoll, wertschätzend, aufbauend, sinnvoll und mit so wenig Leistungsdruck, persönlichen Misserfolgen, sinnlosen Beschäftigungen und monotonen Arbeitsabläufen wie nur irgend möglich zu gestalten. Dann würde sich auf ganz natürliche Weise die „Bildschirmzeit“ ganz von selber nach und nach auf ein gesundes Mass reduzieren.
Peter Sutter, 6. Mai 2024
„Nächstenliebe“, „Demut“, „Bescheidenheit“, „Barmherzigkeit“, „Rücksicht“, „Respekt“, „Ehrlichkeit“ und „Rechtschaffenheit“ – dies die anlässlich seiner Beisetzung am 26. April 2025 wohl am häufigsten erwähnten Charakterzüge von Papst Franziskus. Immer wieder erzählt man sich auch, wie typisch es für ihn gewesen sei, dass er nicht einmal die für so hohe kirchliche Würdenträger vorgesehenen roten Schuhe, die als Symbol für Macht, Würde und höchstes gesellschaftliches Ansehen gelten, getragen hätte, sondern ganz gewöhnliche schwarze Strassenschuhe, und dass er darauf bestanden hätte, dass auf seinem Grabstein nur ein einziges Wort stehen sollte: „Franziscus“. Fürwahr ein kaum zu übertreffendes Vorbild an Menschlichkeit für die ganze Welt.
Weitaus weniger oft aber wurde anlässlich seiner Bestattung erwähnt, dass Papst Franziskus nicht nur ein Mann der Demut und der Nächstenliebe gewesen war, sondern auch ein zutiefst politisch denkender und handelnder Mensch, der mit seiner radikalen Gesellschaftskritik und ganz konkret der Kritik am kapitalistischen Wirtschaftssystem weit über alles hinausgegangen war, was von sämtlichen seiner Vorgänger in dieser Richtung je zu hören gewesen war. „Diese Wirtschaft“, sagte er in Bezug auf den Kapitalismus, „tötet“. Wie Recht er mit dieser Aussage doch hatte, wenn man bedenkt, dass jeden Tag weltweit rund 15’000 Kinder vor dem Erreichen ihres fünften Lebensjahrs sterben, weil sie nicht genug zu essen zu haben, und dies nicht etwa, weil es weltweit zu wenige Nahrungsmittel zur Versorgung aller Menschen gäbe, sondern nur deshalb, weil im Kapitalismus naturgemäss die Güter nicht dorthin fliessen, wo sie am dringendsten gebraucht werden, sondern stets dorthin, wo sich damit am meisten Geld verdienen lässt, sodass sich die Lebensmittel, die in den armen Ländern des Südens so schmerzlich fehlen, umso höher in den reichen Ländern des Nordens auftürmen und bis zu einem Drittel des Gekauften im Müll landet, bevor es überhaupt gegessen wurde. Eine der wohl schlimmsten Menschenrechtsverletzungen unserer Zeit, durchaus vergleichbar mit einem Kriegsverbrechen – ohne dass dies jemals auch nur annähernd so grosse Schlagzeilen machen und eine so grosse Empörung auslösen würde wie kriminelle Taten Einzelner mit zehntausendfach weniger schlimmen Folgen.
Papst Franziskus erkannte auch zwangsläufig den Zusammenhang zwischen Kapitalismus, wirtschaftlicher Expansion, dem Irrglauben an ein unbegrenztes Wirtschaftswachstum und, als letzter Konsequenz von alledem, dem Krieg: „Der Kapitalismus“, sagte er, „braucht den Krieg“. Und: „Es wird nie einen wahren Frieden geben, wenn wir nicht in der Lage sind, ein gerechtes Wirtschaftssystem aufzubauen.“ Auch in diesem Punkt traf seine Kritik voll ins Schwarze, geht es doch in fast allen der zurzeit weltweit wütenden rund 60 Kriegen stets auch um die Vorherrschaft und Inbesitznahme von natürlichen Ressourcen und Bodenschätzen im gegenseitigen Konkurrenzkampf auf dem Schlachtfeld der sogenannten „freien Marktwirtschaft“, die nicht auf dem Prinzip möglichst fairen Nutzens und Teilens des Vorhandenen beruht, sondern bloss auf der Raff- und Profitgier Stärkerer gegenüber Schwächeren.
Wer die Widersprüche und das Zerstörungspotenzial des Kapitalismus so klar erkennt und benennt, muss zwangsläufig zum Schluss kommen, dass auch die NATO als militärischer Arm des westlich-kapitalistischen Machtsystems entgegen allen anderslautenden Behauptungen alles andere ist als ein Instrument zur Verteidigung und Bewahrung von Menschenrechten, Demokratie und Frieden, sondern ganz einfach dazu dient, die Macht der Mächtigen zu sichern und wirtschaftliche Expansion sowie möglichst profitträchtige Ausbeutung von Bodenschätzen und natürlichen Ressourcen zu unterstützen oder gar voranzutreiben. Nur logisch daher die Schlussfolgerung von Papst Franziskus in Bezug auf den Beginn des Ukrainekriegs: „Vielleicht war es ja die NATO, die vor Russlands Tor bellte, was Putins Wut provozierte und ihn dazu veranlasste, die Invasion der Ukraine zu entfesseln. Ich vermute, dass die Haltung des Westens sehr dazu beigetragen hat.“ Diese Aussage machte Papst Franziskus in einem Interview mit dem „Corriere della sera“ am 3. Mai 2022. Wohlweislich wurde sie in keinem einzigen anderen westlichen Mainstreammedium jemals wiedergegeben, hätte dies doch unweigerlich zum Zusammenbruch des so systematisch vom Westen aufgebauten Lügengebäudes geführt, wonach Russland und insbesondere Präsident Putin der einzige und ausschliessliche Schuldige am Ausbruch des Ukrainekriegs sei.
Auch was den Krieg Israels gegen die Menschen im Gazastreifen betritt, stellte sich Papst Franziskus, ohne dass dies jemals gebührend gewürdigt worden wäre und entsprechende Konsequenzen gehabt hätte, mutig gegen die offizielle westlich-kapitalistische Sichtweise, wonach Israel ein „Recht“ hätte, sich gegen den Überfall israelischer Siedlungen durch Hamaskämpfer am 7. Oktober 2023 mit einer tausendfach stärkeren Gegenreaktion zu „verteidigen“, der mittlerweile schon gegen 100’000 unschuldige Kinder, Frauen und Männer zum Opfer gefallen sind: „Was in Gaza geschieht“, sagte Papst Franziskus, „trägt deutlich Züge eines Völkermords.“ Als einziger westlicher Wortführer hatte er den Mut, die israelische Militärpolitik gegen die Palästinenserinnen und Palästinenser als „Terrorismus“ zu bezeichnen. Und sein Papamobil hat er kurz vor seinem Tod den Kindern von Gaza vermacht, wo es nun von der Hilfsorganisation Caritas in einen Krankenweg umgebaut wird.
Mit seiner radikalen Gesellschaftskritik wandelte Papst Franziskus unverkennbar auf den Spuren von Jesus, der ebenfalls zu seiner Zeit zu einer radikalen Umgestaltung der bestehenden Verhältnisse aufgerufen hatte und dafür sein Leben hingeben musste. Es waren und sind die Denkvorstellungen und Visionen einer gerechten und friedlichen Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung, die erst in jenem Moment auf so tragische Weise geopfert wurden, als aus der christlichen „Urkirche“, die eine Art Untergrundbewegung gewesen war, eine „Machtkirche“ wurde, die nicht mehr den Interessen der Armen und der Unterdrückten diente, sondern nur noch den Interessen der Reichen und Mächtigen. Was dazu führte, dass die von Jesus verkündeten Botschaften von Liebe und Gerechtigkeit nicht nur missachtet, sondern geradezu ins Gegenteil verdreht wurden: Ganze Heerscharen von christlichen Kämpfern wurden – wie etwa in den Kreuzzügen des 12. und 13. Jahrhunderts – im Namen Gottes in „heilige“ Kriege gegen Andersgläubige geschickt, Millionen von amerikanischen Ureinwohnerinnen und Ureinwohnern wurden mit Gewalt, Zwang und Folter zum Christentum bekehrt und selbst US-Präsident George W. Bush versäumte es nicht, sein Morgengebet zu verrichten und die Hand auf die Bibel zu legen, bevor er im März 2003 den Befehl zum – wie wir heute wissen – nur mit Lügen gerechtfertigten militärischen Angriff auf den Irak erteilte, dem in der Folge bis zu einer Million unschuldiger Männer, Frauen und Kinder zum Opfer fallen sollten.
Papst Franziskus hat zeitlebens seine Stimme erhoben, um uns daran zu erinnern, dass die revolutionären Visionen von Jesus bis heute nichts an Aktualität eingebüsst haben, ganz im Gegenteil. Elementarste humanitäre Werte wie soziale Gerechtigkeit, Solidarität und Gemeinschaftsdenken, Nächsten- und Feindesliebe sind heute bedrohter denn je. Doch wie vor über 2000 Jahren die Mächtigen sich dieser Bedrohung ihrer Privilegien nicht anders zu entledigen vermochten als dadurch, dass sie Jesus, den „Systemsprenger“, ermordeten, so scheinen auch heute wiederum die Mächtigen all das „Gefährliche“, „Bedrohliche“ und „Unbequeme“, womit uns dieser Papst zum Nachdenken zu bringen versuchte, so schnell wie möglich wieder aus unserer Erinnerung auslöschen und zur „Tagesordnung“ übergehen zu wollen. Im Scheinwerferlicht der Weltöffentlichkeit, just anlässlich der Beisetzung von Papst Franziskus, tummeln sich schon wieder die Reichen und Mächtigen unserer Zeit, ganz so wie damals die Pharisäer, Schriftgelehrten und Geldwechsler, die, als hätte Jesus 2000 Jahre weit in die Zukunft schauen können, in der Bibel mit Worten wie diesen beschrieben sind: „Kurz vor dem jüdischen Passahfest reiste Jesus nach Jerusalem. Dort sah er im Vorhof des Tempels viele Händler, die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere verkauften. Auch Geldwechsler sassen hinter ihren Tischen. Jesus machte sich aus Stricken eine Peitsche und jagte die Händler mit all ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk. Er schleuderte das Geld der Wechsler auf den Boden und warf ihre Tische um.“ Und den Taubenhändlern, die ihm offensichtlich ganz besonders ein Dorn im Auge waren, befahl er: „Schafft das alles hinaus! Das Haus meines Vaters ist doch keine Markthalle!“
Leider sind die Händler, die Geldwechsler und die Taubenhändler bis heute immer und immer wieder in das „Haus des Herrn“ zurückgekehrt. Kaum war Papst Franziskus tot, tummelten sie sich bereits unverfroren, als wäre nichts geschehen, an seinem Grab, um sich im Scheinwerferlicht der Weltöffentlichkeit zu sonnen, und waren voll des scheinheiligen Lobs auf einen Mann, der sie vermutlich, wenn er noch leben würde, in alle Winde verjagt hätte, so wie damals Jesus mit der Peitsche all die Schönredner und Profiteure aus dem Tempel des Herrn verjagte. Franziskus habe „mit seiner Demut und Liebe für die weniger vom Glück Begünstigten weit über die katholische Kirche hinaus Millionen von Menschen inspiriert“ und „mit seinem Vermächtnis zu einer gerechteren, friedvolleren und mitleidsvolleren Welt beigetragen“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, sie, die sich selber ganz offensichtlich nicht im Geringsten von dieser Liebe hat inspirieren lassen, sonst hätte sie wohl kaum jenes EU-„Hilfsprojekt“ in der Höhe von 130 Millionen Euro an vorderster Front in die Wege geleitet, mit dem Tunesien seine Sicherheitskräfte ausbildet, damit sie möglichst viele Flüchtlinge aus dem südlichen Afrika ohne Wasser und Nahrung in die libysche Wüste jagen, Männer, Frauen und Kinder, von denen nur ganz wenige jemals wieder zurückkehren werden, während die toten Körper aller anderen schon längst zum Opfer der Aasgeier geworden sind und nicht einmal das Bild eines dreijährigen Mädchens, das in engster Umklammerung mit seiner Mutter tot in der Wüste von einem Journalisten gefunden wurde, den Weg in die grosse Weltöffentlichkeit gefunden hat.
Die EU-Parlamentspräsidentin Kaja Kallas, die wie kaum eine andere europäische Politikerin auf aggressivste Weise einen zukünftigen grossen Krieg gegen Russland heraufbeschwört und sich für eine militärische Aufrüstung Europas in einem historisch noch nie dagewesenen Ausmass stark macht, sprach vom „unermüdlichen Einsatz“ des verstorbenen Papstes „für den Schutz der Verletzlichsten“ und hob seine „Menschenwürde“ hervor – von seiner Aussage, auch dem ärgsten Feind müsse man die Hand reichen und mit Waffen könnten Konflikte zwischen Ländern und Völkern niemals gelöst werden, scheint sie indessen nie etwas gehört, oder wenn, es dann offensichtlich ganz und gar nicht verstanden zu haben. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, durch sein Schweigen gegenüber dem von der israelischen Regierung im Gazastreifen begangenen Völkermord mitverantwortlich für den Tod Zehntausender unschuldiger Kinder, Frauen und Männer, sagte, Papst Franziskus sei ein „Fürsprecher der Schwachen, ein Versöhner und ein warmherziger Mensch“ gewesen. Der höchstwahrscheinlich zukünftige deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, der ebenfalls voll auf Kriegskurs ist, alle damit verbundenen sozialen, wirtschaftlichen und menschlichen Opfer seiner eigenen Bevölkerung bloss achselzuckend zur Kenntnis nimmt und zudem eine umfassende Verschärfung in der Flüchtlingspolitik, gegenüber den Schwächsten der Schwachen, fordert, erklärte, ohne dabei rot zu werden: „Das ständige wache Mahnen von Papst Franziskus zu sozialer Gerechtigkeit und für die Bewahrung der Schöpfung wird uns ebenso fehlen wie seine Impulse dazu, das Evangelium allen Menschen zu verkünden.“ Der britische Premierminister Keir Starmer, auch er das pure Gegenteil eines von Feindesliebe geprägten Pazifisten, lobte den „Mut“ und die „Demut“ des Verstorbenen. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron, bei der laufenden Verschärfung der Flüchtlingspolitik bedingungslos Seite an Seite mit allen übrigen europäischen Hardlinern, sprach im Zusammenhang mit Papst Franziskus von „Demut“ sowie davon, dass dieser „sich immer auf die Seite der Schwächsten und Zerbrechlichsten gestellt“ hätte. Argentiniens Präsident Javier Milei, bekannt für seine öffentlichen Auftritte mit einer Kettensäge in der Hand, seine rigorosen Sparpläne zu Lasten der ärmsten Bevölkerungsschichten seines Landes symbolisierend, bekundete „tiefe Trauer“ über den Tod von Papst Franziskus und dass es für eine „grosse Ehre“ gewesen sei, dessen „Güte und Weisheit kennenzulernen“.
Anthony Albanese, der australische Ministerpräsident, forderte die Menschheit angesichts des Todes von Papst Franziskus die Menschheit auf, „uns an all das zu erinnern, was wir gemeinsam haben, um den Schrei der Erde, unserer gemeinsamen Heimat, zu hören“ und ordnete an, alle Flaggen seines Landes auf Halbmast wehen zu lassen – ausgerechnet Albanese, der Regierungschef jenes Landes, das in Sachen Asylpolitik weltweit als eines der restriktivsten gilt: Flüchtlingsboote werden aufs offene Meer zurückgedrängt, Flüchtlinge, welche die Küste erreichen, werden fortgeschafft und entweder auf die berüchtigte Insel Nauru, die einer Mondlandschaft gleicht und schon oft mit der Hölle auf Erden verglichen wurde, sowie auf weitere weit entlegene Pazifikinseln verfrachtet, wo gefängnisähnliche Zustände, körperliche Misshandlung und Vergewaltigungen an der Tagesordnung sind. Und der israelische Präsident Isaac Herzog, wenn auch nicht der Hauptverantwortliche, dann doch der engste Komplize von Netanyahu, einem der grössten Kriegsverbrecher unserer Zeit, äusserte sich über den verstorbenen Papst dahingehend, Franziskus sei ein „Mann mit grenzenlosem Mitgefühl“ gewesen, der „sein Leben dem Einsatz für die Armen und dem Ruf nach Frieden in einer unruhigen Welt gewidmet“ habe. Was für eine grenzenlose, unfassbare Scheinheiligkeit und Heuchelei, angesichts derer sich der Verstorbene wohl in diesen wenigen Tagen schon tausende Male in seinem Grab hätte umdrehen müssen…
Erst nach längerem Recherchieren, nachdem ich schon beinahe aufgegeben hätte, bin ich in einer kleinen Lokalzeitung auf folgende Meldung gestossen: Auf dem Grab von Papst Franziskus habe früh am Sonntagmorgen als allererstes eine einzelne weisse Rose gelegen. Und bereits am Tag zuvor hätte eine Gruppe von Kindern, Obdachlosen, Flüchtlingen, Opfern von Menschenhandel, Häftlingen, Transsexuellen und einer Vertretung der Roma-Gemeinschaft weisse Rosen in ihren Händen gehalten. Das wäre wohl die einzige Nachricht gewesen, die es Wert gewesen wäre, weltweit Schlagzeilen zu machen. Denn genau so war auch Jesus gewesen. Nicht bei den Mächtigen, deren Namen in goldenen Lettern prangen und die noch Jahrhunderte später in den Geschichtsbüchern zu lesen sind. Sondern bei den Machtlosen, den Namenlosen, denen, für die nie irgendwelche Denkmäler errichtet werden, obwohl sie die ganze Geschichte der Reichen und Mächtigen, all das Gold, all die Paläste, als die Siege der Starken über die Schwächeren unermüdlich auf ihren Schultern tragen und kein einziger Mensch jemals so reich und so berühmt werden könnte, wenn sie nicht so arm und so namenlos wären. Genau so war Jesus. Er suchte nicht die im Lichte auf, sondern die in der Finsternis, zu den am schmerzlichsten Ausgestossenen fühlte er sich am meisten hingezogen, bei denen, an denen alle achtlos vorbeigegangen, blieb er als Einziger stehen und hörte ihnen als Einziger zu, wenn sie von ihrem Kummer, ihren Sorgen und ihrem Leiden erzählten.
Und immer wieder waren es die Kinder. Schon damals wie auch heute noch immer die Schwächsten der Schwachen. Und so wie Jesus stets die Erwachsenen ermahnte, niemand würde jemals ins „Himmelreich“ kommen, „wenn ihr nicht werdet wie die Kinder“, genau so waren es auch die Kinder, von denen Papst Franziskus so oft erzählte, was ihn so unglaublich bewegt hätte, weil er stets in den Augen der Kinder, auch wenn sie oft voller unsäglicher Traurigkeit waren, zugleich doch immer auch die Hoffnung gesehen hätte, eines Tages würde sich die Erde vielleicht doch noch in jenes Paradies verwandeln, in dem alle Menschen, bevor sie zur Erde kamen, einst gelebt hatten. Diese Hoffnung, die von Menschen wie Jesus und Papst Franziskus und Millionen anderer, Namenloser, stets von Neuem immer wieder entfacht wird und von denen wir, wohl ohne uns der Tragweite dieser Worte gänzlich bewusst zu sein, so beiläufig sagen, solche Menschen seien „ihrer Zeit weit voraus“. Ja, wenn sie ihrer Zeit weit voraus sind, heisst das doch nichts anderes, als dass diese Zeit irgendwann auch tatsächlich kommen wird. Diese Zeit, in der trotz allem eines Tages die Traurigkeit und die Hoffnung in den Augen der Kinder, die Tränen der Freude und die Tränen der Trauer, die Liebe, das Mitgefühl mit Schwächeren, die Feindesliebe, die alles durchklingenden Kräfte der Musik, der Künste und der Phantasie und der Glaube an das Gute im Innersten aller Kreatur stärken geworden sein werden als alles andere und in einem neuen, grossen Ganzen durch Millionen unsichtbarer Fäden der Liebe miteinander verbunden sein werden.
Doch nicht nur die Kinder. Durch alles hindurch fällt in diesen Zeiten auf, dass die stärkste Sehnsucht nach einer friedlichen und gerechten Zukunft, so wie sie von Papst Franziskus verkörpert wurde, vor allem auch bei älteren Menschen spürbar ist, die, so scheint es, in höherem Alter ihre ursprünglichen, kindlichen, mit dem Paradies verbundenen Wurzeln wieder neu entdecken, gepaart mit Jahrzehnten wertvoller Lebenserfahrung: „Wir brauchen“ – auch diese Worte von Papst Franziskus müssen wir für immer in unseren Herzen aufbewahren – „ein neues Bündnis zwischen den Jungen und den Älteren, damit der Lebenssaft derer, die eine lange Lebenserfahrung haben, die Triebe der Hoffnung der Heranwachsenden nährt. So lernen wir die Schönheit des Lebens kennen und schaffen gemeinsam eine geschwisterliche Zukunft.“
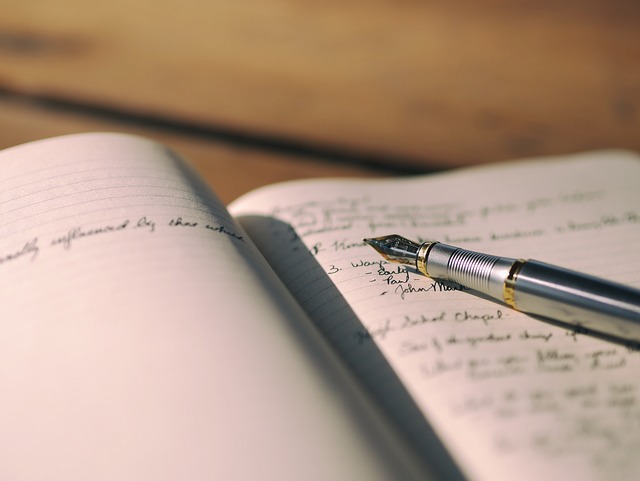
„Die sicherste Tür ist die, die man offen lassen kann.“ (Chinesisches Sprichwort)
„Niemand kann den Morgen erreichen, ohne den Weg der Nacht zu durchschreiten.“ (Kalil Gibran, libanesischer Dichter, 1883-1931)
„Zeige einem schlauen Menschen einen Fehler und er wird sich bedanken. Zeige einem dummen Menschen einen Fehler und er wird dich beleidigen.“ (Laotse, 6. Jahrhundert v.Chr.)
„Wer die Welt bewegen will, sollte erst sich selbst bewegen.“ (Sokrates, griechischer Philosoph, 470-399 v.Chr.)
„Wenn man merkt, dass der Gegner überlegen ist und man Unrecht behalten wird, so werde man persönlich, beleidigend, grob.“ (Arthur Schopenhauer, deutscher Philosoph, 1788-1860)
„Ein gutes Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte.“ (Hans-Georg Gadamer, deutscher Philosoph, 1900-2002)
„Töten ist verboten, deshalb werden Mörder verurteilt. Es sei denn, sie töten in grossen Mengen und zum Klang von Trompeten.“ (Voltaire, französischer Philosoph, 1694-1778)
„Niemand, der bei Verstand ist, zieht den Krieg dem Frieden vor. Im Frieden begraben die Söhne ihre Väter, im Krieg die Väter ihre Söhne.“ (Herodot, griechischer Geschichtsschreiber um 450 v.Chr.)
„Frieden kommt natürlich durch Krieg, er gedeiht auf verseuchtem Boden, auf den Leichen, Ruinen, auf unbewohnbarem Gelände und Hass, seit hunderten Jahren. Ein Hoch allen, die über Alternativen zu diesem Irrsinn nachdenken.“ (Sibylle Berg, deutsche Schriftstellerin)
„Nur ein Verrückter kann Krieg wollen. Krieg zerstört die eigentliche Logik menschlicher Existenz.“ (Pablo Neruda, chilenischer Dichter und Schriftsteller, 1904-1973)
„Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Wasserrohre machen, sondern Stahlhelme und Maschinengewehre, dann gibt es nur eines: Sag NEIN!“ (Wolfgang Borchert, deutscher Schriftsteller, 1921-1947)
„Wenn die Reichen Krieg führen, sterben die Armen.“ (Jean-Paul Sartre, französischer Philosoph, 1905-1980)
„Friede ist nicht Abwesenheit von Krieg. Friede ist eine Tugend, eine Geisteshaltung, eine Neigung zu Güte, Vertrauen, Gerechtigkeit.“ (Baruch de Spinoza, niederländischer Philosoph, 1632-1677)
„Denke niemals, dass ein Krieg, egal wie notwendig oder gerechtfertigt er erscheint, kein Verbrechen ist.“ (Ernest Hemingway, US-amerikanischer Schriftsteller, 1899-1961)
„Die ganze Kriegspropaganda, all das Geschrei, die Lügen und der Hass, kommt immer von Leuten, die selber nicht kämpfen.“ (George Orwell, englischer Schriftsteller und Journalist, 1903-1950)
„Wenn wir uns Kriege ansehen, über die wir mehr wissen, zeigt sich, dass die Menschen vor allem wegen erfundener Geschichten gegeneinander kämpfen.“ (Yuval Noah Harari, israelischer Historiker und Schriftsteller)
„Frieden ist nicht irgendetwas, das man sich wünscht, sondern etwas, das man tut, das man ist und das man weitergibt.“ (John Lennon, britischer Musiker, 1940-1980)
„Die Massen sind niemals kriegslüstern, solange sie nicht durch Propaganda vergiftet werden.“ (Albert Einstein, Physiker, 1879-1955)
„Der Krieg ist der Vater allen Rückschritts.“ (Stefan Zweig, österreichischer Schriftsteller und Pazifist, 1881-1942)
„Kriege, was auch immer ihr Ziel sein mag, schaden der ganzen Menschheit, sie schaden auch den Völkern, die Sieger bleiben.“ (Henri de Saint-Simon, französischer Autor und Sozialist, 1760-1825)
„Wir können das Arsenal der Waffen nicht aus der Welt schreiben, aber wir können das Arsenal der Phrasen, die man hüben und drüben zur Kriegsführung braucht, durcheinanderbringen.“ (Max Frisch, schweizerischer Schriftsteller und Architekt, 1911-1991)
„Dauernder Friede kann nicht durch Drohungen, sondern nur durch den ehrlichen Versuch vorbereitet werden, gegenseitiges Vertrauen herzustellen.“ (Albert Einstein, Physiker, 1879-1955)
„Ich würde gerne sehen, wie jeder einzelne Soldat auf jeder Seite einfach seinen Helm abnimmt, sein Gewehr ablegt und sich an den Rand eines schattigen Weges setzt und sagt: Nein, ich werde niemanden töten. Es gibt genug Leute, die kämpfen wollen. Gebt ihnen die Gewehre.“ (Woody Guthrie, US-amerikanischer Singer-Songwriter, 1912-1967)
„Der ungerechteste Frieden ist immer noch besser als der gerechteste Krieg.“ (Cicero, römischer Philosoph, 106-43 v.Chr.)
„Ich frage mich, ob nicht alle Kriege, alles Blutvergiessen und alles Elend die Schöpfung befallen haben, als ein Mann sich anschickte, eines anderen Mannes Herr zu werden? Und ob dieses ganze Elend nicht weichen wird, wenn alle Zweige der Menschheit die Erde als den gemeinsamen Schatz aller ansehen?“ (Gerrard Winstanley, englischer Politaktivist, 1609-1676)
„Und als der nächste Krieg begann, da sagten die Frauen NEIN und schlossen Bruder, Sohn und Mann fest in der Wohnung ein.“ (Erich Kästner, deutscher Schriftsteller, 1899-1974)
„Wer noch einmal eine Waffe in die Hand nimmt, dem soll die Hand abfallen.“ (Franz Josef Strauss, deutscher CSU-Spitzenpolitiker und langjähriger Ministerpräsident Bayerns, im Jahre 1949).
„Man wird niemals Frieden durch Sicherheit erreichen. Man kann Sicherheit nur durch Frieden erreichen.“ (Johan Galtung, norwegischer Soziologe und Politologe, 1930-2024)
„Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten, nicht den Krieg.“ (Robert Jungk, deutsch-österreichischer Zukunftsforscher, 1913-1994)
„Der Friede erfordert dauernden Dienst, unentwegt und zähe, er verlangt Ausdauer, er lässt keinen Zweifel zu. Zweifel und Skeptik und Misstrauen lähmen den Friedensgedanken.“ (Aristide Briand, französischer Politiker, 1862-1923)
„Unabhängigkeit im Denken ist das erste Kennzeichen der Freiheit. Ohne sie bleibst du ein Sklave der Umstände.“ (Vivekananda, hinduistischer Mönch und Gelehrter, 1863-1902)
„Das Grosse ist nicht, dies oder das zu sein, sondern man selbst zu sein.“ (Søren Kierkegaard, dänischer Philosoph und Schriftsteller, 1813-1855)
„Niemand, dem du beibringst zu denken, kann danach wieder so gehorchen wie zuvor. Nicht aus rebellischem Geist heraus, sondern wegen der Angewohnheit, im Zweifel alle Dinge zu prüfen.“ (Hanna Arendt, deutsch-US-amerikanische Schriftstellerin, 1906-1975)
„Das Stärkste, was ein Mensch haben kann, ist ein freier Geist, der sich durch nichts einschränken lässt.“ (Shi Heng Yi, Meister des Shaolin Temple Europe)
„Ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie äussern dürfen.“ (George Orwell, englischer Schriftsteller und Journalist, 1903-1950)
„Niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei hält, ohne es zu sein.“ (Johann Wolfgang Goethe, deutscher Dichter, Politiker und Naturforscher, 1749-1832)
„Nur im Alleinsein können wir uns selber finden. Alleinsein ist nicht Einsamkeit, sie ist das grösste Abenteuer.“ (Hermann Hesse, deutsch-schweizerischer Schriftsteller und Dichter, 1877-1962)
„Beauty begins the moment you decide to be yourself.“ (Coco Chanel, französische Modeschöpferin und Unternehmerin, 1883-1971)
„Bei sich selbst bleiben und trotzdem offen, das ist der Schlüssel. Das Leben bringt dir immer genau das, was du brauchst. Und wenn du einmal scheiterst, dann wenigstens mit deinem Plan und nicht mit dem eines andern.“ (Chris de Rohr, Schweizer Rockmusiker)
„Was die Herde am meisten hasst, sind diejenigen, die anders denken. Es ist nicht so sehr die Meinung an sich, sondern die Kühnheit, selbst zu denken, etwas, was sie selbst nicht können.“ (Arthur Schopenhauer, deutscher Philosoph, 1788-1860)
„Der Mensch ist nichts anderes als sein Entwurf, er existiert nur in dem Masse, als er sich entfaltet.“ (Jean-Paul Sartre, französischer Philosoph und Schriftsteller, 1905-1980)
„Die Grösse des Menschen liegt an seiner Entscheidung, stärker zu sein als seine Umstände.“ (Albert Camus, französischer Schriftsteller, 1913-1960)
„Selbst denken ist der höchste Mut. Wer wagt, selbst zu denken, der wird auch handeln.“ (Bettina von Arnim, deutsche Schriftstellerin, 1785-1859)
„Gib niemals auf, für das zu kämpfen, was du tun willst. Mit etwas, wo Leidenschaft und Inspiration ist, kann man nicht falsch liegen.“ (Ella Fitzgerald, US-amerikanische Jazzsängerin, 1917-1996)
„Kein Weg ist zu lang für den, der langsam und ohne Eile vorwärts schreitet, und kein lockendes Ziel liegt zu fern für den, der sich mit Geduld rüstet.“ (Jean de la Bruyère, französischer Schriftsteller, 1645-1696)
„Das Gelingen ist manchmal das Endresultat einer ganzen Reihe missglückter Versuche.“ (Vincent van Gogh, niederländischer Maler und Zeichner, 1853-1890)
„Trenne dich nie von deinen Illusionen und Träumen. Wenn sie verschwunden sind, wirst du weiter existieren, aber aufgehört haben zu leben.“ (Mark Twain, US-amerikanischer Schriftsteller, 1835-1910)
„Es gibt Berge, über die man hinüber muss, sonst geht der Weg nicht weiter.“ (Ludwig Thoma, deutscher Schriftsteller, 1867-1921)
„Machtgelüste sind die entsetzlichsten aller Leidenschaften.“ (Publius Cornelius Tacitus, römischer Geschichtsschreiber, etwa 58-120)
„In der normalen Population sind etwa zwei Prozent aller Menschen Psychopathen, die wenigstens davon sitzen im Gefängnis. In der Legalität gibt es eine viel grössere Spielwiese für sie, die können da noch viel besser Macht ausüben.“ (Joe Bausch, deutscher Schauspieler und Autor)
„Die Minderheit der jeweils Herrschenden hat vor allem die Schule, die Presse und meistens auch die religiösen Organisationen in der Hand. Durch diese Mittel beherrscht und leitet sie die Gefühle der grossen Masse und macht diese zu ihrem willenlosen Werkzeug.“ (Albert Einstein, Physiker, 1879-1955)
„Die Freiheit der Presse im Westen ist letztlich die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten.“ (Peter Scholl-Latour, deutsch-französischer Journalist und Sachbuchautor, 1924-2014)
„Macht brauchst du nur, wenn du etwas Böses vorhast. Für alles andere reicht Liebe um es zu erledigen.“ (Charlie Chaplin, britischer Schauspieler und Regisseur, 1889-1977)
„Je näher ein Land seinem Untergang kommt, desto verrückter werden seine Gesetze.“ (Markus Tullius Cicero, römischer Philosoph, 106 bis 43 v.Chr.)
„In den modernen Gesellschaften ist es nicht so, dass eine kleine Gruppe Herrschender andere mit Zwang unterdrückt, sondern dass die herrschende Ordnung ihre Stabilität daraus zieht, dass eine Mehrheit an sie glaubt. Will man die herrschende Ordnung brechen, muss man diesen Glauben brechen. Politischer Kampf ist der Kampf um die Hegemonien an Ideen und Weltverständnissen.“ (Antonio Gramsci, italienischer Schriftsteller, 1891-1937)
„Wenn man merkt, dass der Gegner überlegen ist und man Unrecht behalten wird, so wird man persönlich, beleidigend, grob.“ (Arthur Schopenhauer, deutscher Philosoph, 1788-1860)
„Ich glaube, man kann in anderen Menschen nur das erkennen, was auch in einem selbst irgendwo tief angelegt ist. Deshalb sollte man sich nie über seinen Gesprächspartner erheben. Das Wichtige ist, dass man sich ihm verwandt fühlt oder dass man zumindest die Verwandtschaft zu dem anderen herzustellen fähig ist.“ (Georg Stefan Troller, österreichisch-US-amerikanischer Schriftsteller)
„Wissen ist endlich, Phantasie ist unendlich.“ (Albert Einstein, Physiker, 1879-1955)
„Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Es sind Söhne und Töchter von des Lebens Verlangen nach sich selber. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und sind sie auch bei euch, so gehören sie euch doch nicht.“ (Kahlil Gibran, libanesischer Dichter, 1883-1931)
„Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben: Sterne, Blumen und Kinder.“ (Dante Alighieri, italienischer Dichter, 1265-1321)
„Ich halte nichts von Forderungen nach mehr Geld für Rüstung der NATO. Die Gefahr, dass sich die Situation verschärft wie im August 1914, wächst von Tag zu Tag. Und am Ende landen wir in einem dritten Weltkrieg.“ (Helmut Schmidt, deutscher Bundeskanzler, 1918-2015, im Jahre 2014)
„Amerika steht nicht aus Nächstenliebe an der Seite der Ukraine, sondern weil es in unserem strategischen Interesse ist.“ (Kamala Harris, US-Präsidentschaftskandidatin)
„Vielleicht war es die NATO, die vor Russlands Tor bellt, die Putin dazu veranlasste, die Invasion der Ukraine zu entfesseln. Ich kann nicht sagen, ob seine Wut provoziert wurde, aber ich vermute, dass die Haltung des Westens sehr dazu beigetragen hat.“ (Papst Franziskus, 1936-2025)
„Die Unabhängigkeit der Ukraine beraubte Russland seiner beherrschenden Position am Schwarzen Meer, wo Odessa das unersetzliche Tor für den Handel mit dem Mittelmeer und der Welt jenseits davon war.“ (Zbigniew Brzezinski, US-Politberater, 1928-2017)
„Wenn du die Wahrheit willst, geh los und suche sie. Genau davor haben sie Angst.“ (Julian Assange, Sprecher der Enthüllungsplattform Wikileaks)
„Die grösste Gefahr in der Moderne geht nicht von der Anziehungskraft nationalistischer oder rassistischer Ideologien aus, sondern vom Verlust an Wirklichkeit. Wenn der Widerstand durch Wirklichkeit fehlt, dann wird prinzipiell alles möglich.“ (Hanna Arendt, deutsch-US-amerikanische Schriftstellerin, 1906-1975)
„Die Lüge wird zur Weltordnung gemacht.“ (Franz Kafka, österreichisch-tschechischer Schriftsteller, 1883-1924)
„Es wurde bisher grundsätzlich immer nur die Wahrheit verboten.“ (Franz Kafka, österreichisch-tschechischer Schriftsteller, 1883-1924)
„Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt, die Wahrheit kann von allein aufrecht stehen.“ (Thomas Jefferson, US-Präsident, 1743-1826)
„Die Wahrheit ist eine unzerstörbare Pflanze. Man kann sie ruhig unter einem Felsen vergraben, sie stösst sich trotzdem durch, wenn es an der Zeit ist.“ (Frank Thiess, deutscher Schriftsteller, 1890-1977)
„Man sieht die Welt nicht so, wie sie ist. Man sieht die Welt so, wie man selbst ist.“ (AnaÏs Nin, US-amerikanische Schriftstellerin, 1903-1977)
„Das ganze System beruht auf der Idee, dass man der Mehrheit alles einreden kann, solange man es genug laut und oft wiederholt.“ (Edward Snowden, US-amerikanisch-russischer Whistleblower)
„Es ist leichter, eine Lüge zu glauben, die man tausendmal hört, als die Wahrheit, die man nur einmal hört.“ (Abraham Lincoln, US-Präsident, 1809-1865)
„Die Freiheit der Presse im Westen ist letztlich die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten.“ (Peter Scholl-Latour, deutsch-französischer Journalist und Sachbuchautor, 1924-2014)
„Und ein solches Volk, das sich seiner Macht, zu denken und zu urteilen, beraubt sieht, ist auch, ohne es zu wissen und zu wollen, dem Gesetz der Lüge vollständig unterworfen. Mit einem solchen Volk kann man dann machen, was man will.“ (Hanna Arendt, US-amerikanische Philosophin, 1906-1975)
„Die Behauptung, ich sei ein Antisemit, weil ich mich gegen den versuchten Völkermord an den Ureinwohnern Palästinas eingesetzt habe, ist hinfällig. Die Menschen in der Welt haben die Mauern des Hasses und das Lügengewebe durchschaut.“ (Roger Waters, Musiker von Pink Floyd)
„Wir müssen die Araber vertreiben und ihren Platz einnehmen.“ (David Ben Gurion, erster Premierminister Israels, 1886-1973)
„Macht ihr Leben so bitter, dass sie bereitwillig von selbst den Transfer machen.“ (Benny Alon, israelischer Tourismusminister)
„Es muss klar sein, dass es in diesem Land keinen Platz für beide Völker gibt. Die einzige Lösung ist ein Land ohne Araber.“ (Josef Weitz, Leiter der Landsiedlungsabteilung des jüdischen Nationalfonds JNF, im Jahre 1940)
„Ich verstehe die Parole FROM THE RIVER TO THE SEE, PALESTINE WILL BE FREE so, dass die Region vom Jordan bis zum Mittelmeer frei sein soll von Krieg und Diskriminierung. Dies bedeutet nichts anderes als die friedliche Lösung des Nahostkonflikts.“ (Ruth Dreifuss, ehemalige Schweizer Bundesrätin mit jüdischen Wurzeln)
„Zurzeit haben nur Idealisten eine realistische Alternative zum Albtraum.“ (Omri Boehm, israelisch-deutscher Philosoph)
„Die DDR hatte eine Utopie. Die ist gescheitert. Dieses mein Land, Deutschland heute, hat keine Utopie. Ich sehe keine. Ausser Geldvermehrung.“ (Jens Winkelmann, ehemaliger Mitarbeiter im DDR-Aussenministerium)
„Wahre Bildung besteht darin, den Menschen beizubringen, alleine zu denken.“ (Noam Chomsky, US-amerikanischer Sprachwissenschaftler und politischer Publizist)
„Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man in der Schule gelernt hat.“ (Albert Einstein, Physiker, 1879-1955)
„Der Mensch ist nichts anderes als sein Entwurf, er existiert nur in dem Masse, als er sich entfaltet.“ (Jean-Paul Sartre, französischer Dramatiker und Philosoph, 1905-1980)
„Die beste Bildung findet ein Mensch auf Reisen.“ (Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Dichter, Politiker und Naturforscher, 1749-1823)
„Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie schon längst verboten.“ (Kurt Tucholsky, deutscher Schriftsteller, 1890-1935)
„Diejenigen, die das Privileg haben, zu wissen, haben die Pflicht zu handeln.“ (Albert Einstein, Physiker, 1879-1955)
„Die Regierungen und alle Politiker sollen für die Allgemeinheit arbeiten. Sie sollen nicht nur auf die ökonomischen Eliten hören, sondern der Bevölkerung zu Dienst stehen, die Land, Wohnung, Arbeit und ein gutes Leben im Einklang mit der Menschheit und der Schöpfung suchen.“ (Papst Franziskus, 1936-2025)
„Politik kann man niemals mit der gleichen Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“ (Albert Einstein, Physiker, 1879-1955)
„Wer die Geschichte nicht kennt, wird die Zukunft nicht in den Griff bekommen.“ (Golo Mann, deutsch-schweizerischer Historiker und Schriftsteller, 1909-1994)
„Hat denn Europa jemals vertrauensvoll auf die Russen geblickt, kann es das überhaupt: vertrauensvoll und nicht feindselig auf uns blicken? Wird es das jemals können?“ (Fjodor Michailowitsch Dostojewski, russischer Schriftsteller, 1821-1881)
„Während seiner ersten Amtszeit verfolgt Putin bis 2004 eine Politik der offenen Tür zu Europa und den westlichen Ländern. Erst als sich immer mehr ehemalige Sowjetrepubliken dem Westen zuwenden, verändert sich seine Haltung dem Westen gegenüber zu einer zunehmend feindseligeren Politik.“ (Michael Eltchaninoff, französischer Philosoph und Autor)
„Russland wurde von den Amerikanern und ihren Freunden komplett kolonialisiert. Sie waren in den 90er-Jahren omnipräsent, in den Ministerien und in den Banken. Sogar im Aussenministerium erhielt ich Mitteilungen der amerikanischen Botschaft, in denen stand, was ich zu diesem oder jenem Thema zu sagen oder zu tun hätte.“ (Alexander Orlov, russischer Botschafter in Frankreich von 2008 bis 2017)
„Einige Jahre nach dem Ende des Kalten Kriegs waren von Hybris, Arroganz und übertriebener Siegessicherheit des Westens gekennzeichnet.“ (Hubert Védrine, französischer Aussenminister von 1997 bis 2002)
„Als die Sowjetunion zusammenbricht, ist das für Putin eine Tragödie, weil damit alle seine Jugendideale, der Patriotismus, der Dienst am Staat und die Opposition gegenüber dem Westen am Boden liegen.“ (Michel Eltchaninoff, Philosoph und Autor, geb. 1969)
„Während seiner ersten Amtszeit verfolgt Putin bis 2004 eine Politik der offenen Tür zu Europa und den westlichen Ländern. Erst als sich immer mehr ehemalige Sowjetrepubliken dem Westen zuwenden, verändert sich seine Haltung dem Westen gegenüber zu einer zunehmend feindseligeren Politik.“ (Michel Eltchaninoff, Philosoph und Autor, geb. 1969)
„Es ist kein Zeichen von Gesundheit, an eine von Grund auf kranke Gesellschaft gut angepasst zu sein.“ (Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Schriftsteller, 1749-1832)
„Geh deinen Weg und lass die Leute reden.“ (Dante Alighieri, italienischer Dichter und Philosoph, 1265-1321)
„Alle Dinge teilen denselben Atem – das Tier, der Baum, der Mensch… Die Luft teilt ihren Geist mit allem Leben, das sie unterstützt.“ (Häuptling Seattle, 1786-1866)
„Wir alle stecken in einem grossen Dilemma: Wir zerstören den Globus.“ (Georg Schütte, Generalsekretär der Volkswagenstiftung, geb. 1962)
„Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier.“ (Mahatma Gandhi, indischer Freiheitskämpfer, 1869-1948)
„Jeder, der glaubt, exponentielles Wachstum kann andauernd weitergehen in einer endlichen Welt, ist entweder ein Verrückter oder ein Ökonom.“ (Kenneth E. Boulding, US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, 1910-1993)
„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.“ (indianische Weisheit)
„Die alte Welt stirbt, und die neue Welt kämpft darum, geboren zu werden. Jetzt ist die Zeit der Monster.“ (Antonio Gramsci, italienischer Schriftsteller, 1891-1937)
„Man darf nie aufhören, sich die Welt so vorzustellen, wie sie am vernünftigsten wäre.“ (Friedrich Dürrenmatt, Schweizer Schriftsteller und Dramatiker, 1921-1990)
„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.“ (Albert Einstein, Physiker, 1879-1955)
„Wir brauchen ein neues Bündnis zwischen den Jungen und den Älteren, damit der Lebenssaft derer, die eine lange Lebenserfahrung haben, die Triebe der Hoffnung der Heranwachsenden nährt. So lernen wir die Schönheit des Lebens kennen und schaffen eine geschwisterliche Gesellschaft.“ (Papst Franziskus, 1936-2025)
„Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, so ist das der Beginn einer neuen Wirklichkeit.“ (Dom Helder Camara, brasilianischer Erzbischof, 1909-1999)
„Was mir Hoffnung gibt? Die Menschen, die Tiere und die Bäume und all die Dinge, die schön sind und zum Teil auch immer gut. Und die feste Überzeugung, dass die meisten Menschen Frieden wollen und ihre Ruhe, und die Kinder sollen es gut haben und die Nachbarn auch. Vielleicht wird ja nicht alles schlimmer, sondern besser. Die Chancen sind gleich gross.“ (Sibylle Berg, deutsch-schweizerische Autorin)
„Man kann das Leben nur rückwärts verstehen, aber man muss es vorwärts leben.“ (Søren Kierkegaard, dänischer Philosoph und Schriftsteller, 1813-1855)
„Wer wirklich Neues erdenken will, kann gar nicht genug verrückt sein.“ (Niels Bohr, dänischer Physiker, 1885-1962)
„Sie ändern die Dinge nie, indem Sie gegen die bestehende Realität ankämpfen. Um etwas zu ändern, müssen Sie ein neues Modell entwickeln, das das bestehende Modell überflüssig macht.“ (Buckminster Fuller, amerikanischer Architekt, 1895-1983)
„Die reinste Form des Wahnsinns ist, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.“ (Albert Einstein, Physiker, 1879-1955)
„Das Geheimnis des Wandels: Konzentriere nicht deine ganze Kraft auf das Bekämpfen des Alten, sondern darauf, das Neue zu formen.“ (Sokrates, griechischer Philosoph, 469-399 v.Chr.)
„Ein neuer Gedanke wird zuerst verlacht, dann bekämpft, bis er nach längerer Zeit als selbstverständlich gilt.“ (Arthur Schopenhauer, deutscher Philosoph, 1788-1860)
„Die Frage heute ist, wie man die Menschheit überreden kann, in ihr eigenes Überleben einzuwilligen.“ (Bertrand Russell, britischer Philosoph, 1872-1970)
„Kritiker haben wir genug. Was unsere Zeit braucht, sind Menschen, die ermutigen.“ (Konrad Adenauer, ehemaliger deutscher Bundeskanzler, 1876-1967)
„Es gibt für einen Schriftsteller nichts Besseres als eine schlechte Kindheit. Da kann man ein Leben lang daraus schöpfen.“ (Elke Heidenreich, deutsche Schriftstellerin und Kabarettistin)
„Menschen, die sich von Anfang an anstrengen mussten, die gescheitert sind und ihre Ziele nicht auf Anhieb erreicht haben, sind am Ende erfolgreicher.“ (Adam Grant, US-amerikanischer Autor und Psychologie)
„Ich bin nicht gescheitert – ich habe zehntausend Wege entdeckt, die nicht funktioniert haben.“ (Thomas Alva Edison, US-amerikanischer Erfinder, 1847-1931)
„Schon mal versucht. Schon mal gescheitert. Versuche es nochmals. Scheitere noch einmal. Scheitere besser.“ (Samuel Beckett, irischer Schriftsteller, 1906-1989)
„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“ (Bertolt Brecht, deutscher Dramatiker und Lyriker, 1898-1956)
„Wer scharf denkt, wird Pessimist, wer tief denkt, wird Optimist.“ (Henri Bergson, französischer Philosoph, 1859-1941)
„Es gibt viele Gründe traurig zu sein. Aber ich begann zu verstehen, dass Leid und Enttäuschungen nicht dazu da sind, um uns zu ärgern, herabzusetzen oder unsere Würde zu verlieren, sondern dazu, um uns reifen zu lassen und zu verwandeln.“ (Hermann Hesse, deutsch-schweizerischer Schriftsteller, 1877-1962)
„Hoffnung geben mir die Menschen, die Tiere und die Bäume und all die Dinge, die schön sind und zum Teil auch immer gut. Und die feste Überzeugung, dass die meisten Menschen Frieden wollen und ihre Ruhe, und die Kinder sollen es gut haben und die Nachbarn auch. Vielleicht wird ja nicht alles schlimmer, sondern besser. Die Chancen sind gleich gross.“ (Sybille Berg, deutsche Schriftstellerin, geboren 1962)
„Tu zuerst das Notwendige, dann das Mögliche, und plötzlich schaffst du das Unmögliche.“ (Franz von Assisi, Begründer des Franziskanerordners, 1182-1226)
„Der Westen hat die Welt nicht durch seine Überlegenheit, seine Ideen, seine Werte oder seine Religion erobert, sondern durch seine Überlegenheit beim Anwenden organisierter Macht. Westler vergessen diese Tatsache oft, Nichtwestler nie.“ (Samuel Huntington, US-Politwissenschaftler, 1927-2008)
„Russlands Bodenschätze sind zu gewaltig, als dass sie den Russen allein gehören dürfen.“ (Madeleine Albright, ehemalige US-Aussenministerin, 1937-2022)
„Einige Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges waren von Hybris, Arroganz und übertriebener Siegessicherheit des Westens gekennzeichnet.“ (Hubert Védrine, ehemaliger französischer Aussenminister)
„Als die Sowjetunion 1991 zusammenbricht, ist das für Putin eine Tragödie, weil damit alle seine Jugendideale, der Patriotismus, der Dienst am Staat und die Opposition gegenüber dem Westen am Boden liegen.“ (Michael Eltchaninoff, französischer Philosoph und Autor)
„Es muss doch etwas faul sein im Innersten eines Gesellschaftssystems, das seinen Reichtum vermehrt, ohne sein Elend zu verringern.“ (Karl Marx, deutscher Philosoph und Schriftsteller, 1818-1883)
„Kapitalismus tötet.“ (Papst Franziskus, 1936-2025)
„Der Kapitalismus braucht den Krieg.“ (Papst Franziskus, 1936-2025)
„Das Kapital entwickelte sich ferner zu einem Zwangsverhältnis, welches die Arbeiterklasse nötigt, mehr Arbeit zu verrichten, als der enge Umkreis ihrer eignen Lebensbedürfnisse vorschrieb.“ (Karl Marx, deutscher Philosoph und Schriftsteller, 1818-1883)
„Der Kapitalismus hat die Menschen im Stich gelassen. Wenn es Hunderttausende von Kindern gibt, die nicht genug zum Überleben haben, ist das ein eklatanter Misserfolg. Wie könnte man es sonst beschreiben?“ ( frühere Jacinda Ardern, neuseeländische Premierministerin, geb. 1980)
„Die Welt ist viel zu gefährlich, um darin zu leben. Nicht wegen der Menschen, die Böses tun. Sondern wegen der Menschen, die daneben stehen und sie gewähren lassen.“ (Albert Einstein, Physiker, 1879-1955)
„Der grösste Schaden entsteht durch die schweigende Mehrheit, die nur überleben will, sich fügt und alles mitmacht.“ (Sophie Scholl, deutsche Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus, 1921-1943)
„Leben heisst Partei ergreifen. Gleichgültigkeit ist ein mächtiger Faktor in der Geschichte.“ (Antonio Gramsci, italienischer Schriftsteller, 1891-1937)
„Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bliebe.“ (Die Ärzte, deutsche Rockband)
„Gibt es eine Möglichkeit, die psychische Entwicklung des Menschen so zu leiten, dass sie der Psychologie des Hasses und des Vernichtens gegenüber widerstandsfähiger werde!“ (Albert Einstein, Physiker, 1879-1955)
„Du musst so viel Liebe aufbringen, damit aus deinem Feind ein Freund wird.“ (Martin Luther King, US-amerikanischer Bürgerrechtskämpfer, 1929-1968)
„Wir sind auf der Welt, um es uns unbequem zu machen und denen, die uns brauchen, entgegenzugehen. So finden wir uns selbst wieder. Wer sich für die anderen verausgabt, gewinnt sich selbst, denn das Leben besitzt man nur, wenn man es hinschenkt.“ (Papst Franziskus, 1936-2025)
„Der erste Schritt zur Gewaltlosigkeit ist, alles zu respektieren, was lebt.“ (Albert Schweitzer, deutsch-französischer Arzt, Theologe und Philosoph, 1875-1956)
„Wir sind, was wir denken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt.“ (Siddharta Gautama Buddha, Begründer des Buddhismus, vor rund 2500 Jahren in Indien lebend)
„Die perfekte Diktatur wird den Anschein einer Demokratie machen, einem Gefängnis ohne Mauern, in dem die Gefangenen nicht einmal davon träumen auszubrechen. Es ist ein System der Sklaverei, bei dem die Sklaven dank Konsum und Unterhaltung ihre Liebe zur Sklaverei entwickeln.“ (Aldous Huxley, britischer Schriftsteller und Philosoph, 1894-1963)
„Demokratie ist die Methode, den Willen des Finanzadels so umzusetzen, dass das Volk glaubt, die Mehrheit habe es so gewollt.“ (Matthias Lubos, deutscher Produzent und Komponist)
„Wie viel ist schon gewonnen, wenn nur einer aufsteht und Nein sagt.“ (Bertolt Brecht, deutscher Dramatiker und Lyriker, 1898-1956)
„Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen: Nein.“ (Kurt Tucholsky, deutscher Schriftsteller, 1890-1935)
„Die grösste Tragödie im Leben ist das Aufgeben des Kampfes.“ (Nikolai Ostrowski, sowjetischer Schriftsteller und Revolutionär, 1904-1936)
„Du hast Feinde? Gut. Das bedeutet, dass du dich irgendwann in deinem Leben für etwas eingesetzt hast.“ (Victor Hugo, französischer Schriftsteller und Politiker, 1802-1885)
„Nur ein Atheist kann ein guter Christ sein.“ (Ernst Bloch, deutscher Philosoph, 1885-1977)
„Wohltätigkeit ist das Ersäufen des Rechts im Mistloch der Gnade.“ (Johann Heinrich Pestalozzi, Schweizer Pädagoge und Schriftsteller, 1746-1827)
„Reicher Mann und armer Mann standen da und sahn sich an. Und der Arme sagte zum Reichen bleich: Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.“ (Bertolt Brecht, deutscher Dichter, 1898-1956)
„Die Behauptung, es gäbe kein Geld, um das Elend in der Welt zu beseitigen, ist eine Lüge. Wir haben auf der Erde Geld wie Dreck, es haben nur die falschen Leute.“ (Heiner Geissler, CDU-Politiker, 1930-2017)
„Das Problem sind die Männer. Keine Frau hat nachts Angst, wenn sie migrantischen Frauen begegnet, sondern sie hat Angst, wenn sie Männern begegnet, egal ob sie migrantisch sind oder nicht.“ (Heidi Reichinnek, deutsche Politikerin, geb. 1988)
„Man muss Menschen schützen, nicht Grenzen.“ (Giusi Nicolini, ehemalige Bürgermeisterin von Lampedusa, geb. 1961)
„Das Bruttosozialprodukt misst alles, ausser dem, was das Leben lebenswert macht.“ (Robert Kennedy, US-Senator und Justizminister, 1925-1968)
„Wo immer ein Tier in den Dienst des Menschen gestellt werden, gehen die Leiden, die es erduldet, uns alle an.“ (Albert Schweitzer, deutsch-französischer Arzt und Philosoph, 1875-1965)
Peter Sutter, 20. April 2025

Die Schweiz, das „Musterland“ der Demokratie, der Meinungs- und Gedankenfreiheit. In keinem anderen Land der Welt würden die Menschen durch die Medien so ausgewogen und objektiv informiert wie hierzulande, heisst es meist im Brustton tiefster Überzeugung. Doch wir brauchen nur irgendeine beliebige Zeitungsseite aufzuschlagen, um sogleich festzustellen, dass dieses Bild nichts anderes ist als reines Wunschdenken. Die Art und Weise, wie westliche Medien ihr Publikum manipulieren, ist vermutlich sogar noch viel raffinierter als jene plumpen „Holzhammermethoden“, welche in Diktaturen oder rigiden Einparteiensystemen an der Tagesordnung sind. Und deshalb nicht weniger, sondern vielleicht sogar noch gefährlicher. Denn wenn man sich beim Lesen oder Hören einer Nachricht nicht einmal bewusst ist, dass man manipuliert wird, können Lügen viel leichter und schneller zu vermeintlichen „Wahrheiten“ heranwachsen, als wenn man Gelesenem und Gehörtem grundsätzlich misstraut.
Zum Beispiel Seite 7 des „St. Galler Tagblatts“ vom 14. April 2025. Scheinbar „objektiv“ wird auf der gleichen Zeitungsseite sowohl über einen russischen Raketenschlag gegen die ukrainische Stadt Sumy wie auch über einen israelischen Luftangriff gegen Ziele im Gaza-Streifen berichtet. Doch schauen wir uns die beiden Meldungen etwas genauer an…
Zunächst die Länge: Der links abgedruckte Artikel über die Attacke auf Sumy ist ungefähr drei Mal so lang wie der rechts abgedruckte über die Angriffe im Gaza-Streifen. Da beim Lesen unbewusst die Länge eines Artikels mit der Bedeutung der betreffenden Nachricht in Verbindung gebracht wird, bedeutet dies im Klartext: Was in Sumy geschehen ist, muss drei Mal schlimmer gewesen sein als das, was im Gaza-Streifen geschehen ist. Auch alle weiteren Unterschiede in der Gewichtung der beiden Ereignisse unterstreichen diese Aussage, die sich somit der Leserschaft gleich auf mehreren unterschiedlichen Ebenen nachhaltig einprägt.
Zweitens die Visualisierung: Im linken Artikel nimmt das Bild so viel Raum ein wie der gesamte Text des rechten Artikels, in welchem eine Visualisierung in Form eines Bildes sogar gänzlich fehlt. Das Bild über die Attacke auf Sumy zeigt riesige schwarze Rauchschwaden, lichterloh brennende Fahrzeuge, eine völlig zerschossene Häuserfassade, tote und lädierte Baumstämme, herumliegende Gebäudereste, eine mit Trümmern übersäte Strasse und einen einzelnen schwarz gekleideten Mann, der fassungslos daneben steht – selbst all denen, die den zugehörigen Text bloss überfliegen bzw. gar nicht zur Kenntnis nehmen, um rasch weiterzublättern, wird sich ein solches Bild zweifellos tief einprägen, zumal es noch mit der Legende, dass es sich dabei um eine „Zerstörung“ und eine „verheerende“ russische Raketenattacke gehandelt habe, versehen ist. Man kann nur erahnen, was auf einem Bild im rechten Artikel zu sehen gewesen wäre, hätte man die beiden Nachrichten auch nur ein ganz winziges bisschen neutraler und ausgewogener darzustellen versucht.
Drittens die Grösse und der Inhalt der beiden Titel: Der linke Titel ist mit einer mehr als drei Mal so grossen Schrift gedruckt. Zudem weckt er starke Emotionen, wenn von einem „Blutbad“ die Rede ist. Ganz im Gegensatz zum Titel des rechten Artikels, der nicht nur in einer viel kleineren Schrift erscheint, sondern auch völlig „sachlich“ und emotionslos formuliert ist: „Israel greift über 90 Ziele im Gaza-Streifen an“. 90 Ziele, man stelle sich das einmal vor. Das war dann höchstwahrscheinlich nicht bloss ein einziges Blutbad, sondern geradezu ein Meer von Blut!
Viertens der Untertitel. Gleich vierfach – wie wenn einmal nicht genug wäre – wird der Leserin und dem Leser eingehämmert, wie schlimm der russische Angriff gewesen sein muss: Er hat die „kriegsgeplagte“ Stadt Sumy getroffen, es war eine „Attacke“, diese war „verheerend“ und forderte „über 30 Tote“. Der rechte Artikel hingegen weist überhaupt keinen Untertitel auf. Untertitel sind aber in der Wirkung auf die lesende Person von grösster Wichtigkeit. Flüchtig und oberflächlich Lesende verschaffen sich häufig bloss aufgrund von Titel und Untertitel eine Meinung und nehmen den Text selber gar nicht zur Kenntnis. Fehlt, wie im rechten Artikel, ein Untertitel, bleibt bei der lesenden Person nicht einmal ein flüchtiger, sondern überhaupt kein Eindruck zurück.
Fünftens die Zahl der Opfer. Während im linken Artikel präzise die Zahl von 32 Toten genannt wird, fehlt im rechten Artikel jegliche Zahlenangabe. Die Rede ist nur von „90 Zielen“. Die Angriffe hätten sich auf „Waffenlager“, „Terrorzellen“ und „militärische Anlagen“ beschränkt – wobei solche sogenannte „chirurgische“ Angriffe, wie allgemein bekannt ist, stets auch verheerende Auswirkungen haben auf Wohngebiete oder zivile Einrichtungen in ihrem näheren und weiteren Umfeld. Zudem sei die laufende Bodenoffensive im Süden des Gaza-Streifens fortgesetzt worden und zuvor sei noch ein Krankenhauskomplex im Norden des Gaza-Streifens angegriffen worden. Zählt man die Opfer der 90 „Ziele“, der Bodenoffensive sowie der Attacke auf den Krankenhauskomplex zusammen, kommt man selbst bei vorsichtigen Schätzungen auf eine Zahl, die vermutlich die Opfer der russischen Attacke auf Sumy um mindestens das Zehnfache, wenn nicht das Zwanzigfache übertreffen dürfte. Dass dabei so ganz nebenbei auch noch ein Krankenhauskomplex ins Visier des israelischen Bombardements geriet, wird auch nicht mit einem einzigen Wort kritisch kommentiert, obwohl man hierfür objektiverweise wohl noch weitaus drastischere Begriffe verwenden müsste als das im linken Artikel genannte „Blutbad“.
Sechstens die Beschreibung der Opfer. Im linken Artikel werden die Opfer und die an ihnen begangenen Taten detailliert beschrieben, vermutlich, um an das Mitgefühl der lesenden Person zu appellieren und zugleich Hass- und Rachegefühle gegen die Täter zu erzeugen. Unter den 32 Toten seien auch „zwei Kinder“ gewesen, unter den 84 Verletzten „acht Kinder“. Die Menschen seien „am Palmsonntag“, also an einem heiligen Tag, in der Stadt gewesen, als die Raketen eingeschlagen hätten. Die Raketen hätten „Sprengsätze mit Streubomben“ getragen.“ Viele Menschen seien „mitten auf der Strasse, in Autos und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Häusern“ verletzt worden. Auf Bildern hätte man „leblose Körper auf Strassen“ gesehen. Rettungskräfte hätten Menschen „mit blossen Händen“ getragen. Im rechten Artikel dagegen sucht man vergeblich nach vergleichbaren Details. Kein Hinweis darauf, ob es auch – was höchst wahrscheinlich ist – Opfer unter Kindern gegeben hat. Kein Hinweis darauf, wo und wie die Menschen getötet oder verletzt wurden. Kein Hinweis darauf, was für Waffen eingesetzt wurden. Alles schön emotionslos, „sachlich“, um nur ja nicht gegen die für diese Gewalttaten verantwortlichen israelischen Machthaber ähnliche Hass- oder Rachegefühle aufkommen zu lassen wie gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin, an dem westliche Medien geradezu schon notorisch nie auch nur den kleinsten guten Faden lassen.
Siebtens die Parteinahme. Zwar wird sie nicht offen ausgesprochen, ist aber auf Schritt und Tritt zwischen den Zeilen wahrzunehmen. Der Autor des linken Artikels steht unverkennbar auf der Seite der Ukraine. Der Angriff auf Sumy hätte „international Entsetzen ausgelöst“. Russland habe „eine möglichst hohe Zahl an Zivilpersonen treffen wollen“, der ukrainische Aussenminister hätte von einem „Kriegsverbrechen“ gesprochen, der deutsche Bundeskanzler hätte gesagt, solche Angriffe zeigten, „wie es um die angebliche russische Friedensbereitschaft bestellt“ sei. Und dass es Russland einzig und allein nur darum gehe, „seinen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine erbarmungslos fortzusetzen“. Auch Frankreichs Präsident Macron hätte geschrieben, dass „Russland menschlichem Leben keinen Wert beimisst“ und „den Krieg weiterführen will“. Der ukrainische Aussenminister Sybiha hätte gar vom „absoluten Bösen“ gesprochen, und das „an einem wichtigen christlichen Feiertag in einer friedlichen ukrainischen Stadt“. Er und Selenski würden „eine entschlossene Reaktion der internationalen Verbündeten fordern“, denn sonst „würde Russland seinen Terror immer mehr ausweiten“. Sybiha fordere zudem die westlichen Partner auf, „die Ukraine mit zusätzlichen Flugabwehrkapazitäten auszustatten und den Druck auf Moskau zu erhöhen“. Im rechten Artikel über die Angriffe der israelischen Luftwaffe sucht man dergleichen Zuspitzungen vergebens, obwohl diese israelische Militäraktion ohne alle Zweifel weitaus mehr Tote und Verletzte gefordert hatte als der russische Angriff auf Sumy. Kein Wort darüber, dass man das Zerstörungswerk Israels im Gazastreifen, wenn man schon den russischen Angriff auf Sumy als „Kriegsverbrechen“ bezeichnet, konsequenterweise als mindestens so schweres, wenn nicht noch schwereres Kriegsverbrechen bezeichnen müsste. Kein Wort darüber, dass, wenn die Ereignisse von Sumy „internationales Entsetzen ausgelöst“ hätten, dies für die Luftangriffe Israels auf 90 Ziele im Gaza-Streifen mindestens so sehr angebracht gewesen wäre. Kein Wort darüber, dass auch die israelische Regierung „menschlichem Leben“ offenbar „keinen Wert“ beimesse. Kein Wort darüber, dass die israelische Regierung vor wenigen Tagen den zwischen ihr und der Hamas ausgehandelten Waffenstillstand einseitig und ohne Begründung gebrochen hatte. Stattdessen wird nur hervorgehoben, dass die israelische Armee „die Einwohner von Chan Junis im Süden des Küstenstreifens vor einem bevorstehenden Angriff gewarnt“ und sie aufgefordert hätte, „sich zu den Schutzräumen zu begeben“. Auch das Personal des bombardierten Krankenhauskomplexes sei „vorab gewarnt und zur Evakuierung des Gebäudes aufgefordert“ worden. Und „vor der Attacke“ seien „Massnahmen“ ergriffen worden, „um die Schäden möglichst gering zu halten, etwa durch Warnungen und den Einsatz von Präzisionsmunition“. Mit anderen Worten: Alle, die durch die Angriffe Israels getötet oder verletzt worden sind, sind selber Schuld, sie hätten ja den Warnungen seitens des Militärs nur Folge leisten müssen. Was für ein grenzenloser Zynismus! Nicht nur, dass man damit jegliche noch so grenzenlose Brutalität und Missachtung elementarster Menschenrechte rechtfertigen kann – sie sind ja selber Schuld, sie hätten nur auf die Warnungen hören müssen -, sondern auch, weil ja die Evakuierung eines Spitals inmitten eines total verwüsteten Gebiets, indem kaum mehr ein Stein auf dem andern steht, nichts ist als reine Augenwischerei. Wohin sollen die Kranken und Schwerverletzten denn gebracht werden, wo soll man die medizinischen Geräte installieren, mit was für Material und Instrumenten soll das Personal denn arbeiten? Die „Warnungen“ sind doch nichts anderes als ein grenzenlos unverschämter Propagandatrick, um sich allenfalls zu befürchtete internationale Kritik möglichst vom Hals zu schaffen, indem man den Spiess umdreht und die Opfer zu Tätern macht: Selber Schuld, sie hätten ja nur den so gut gemeinten Ratschlägen ihrer potenziellen Mörder Folge leisten müssen. Und der Schweizer Journalist, der diesen Artikel geschrieben hat, spielt das üble Spiel brav und willfährig mit und äussert nicht einen Funken Kritik an einer dermassen perfiden, skrupellosen und aller minimalster Menschlichkeit entbehrenden Kriegsführung.
Achtens die zitierten Personen. Im Artikel über die russische Attacke in Sumy werden mit dem ukrainischen Präsidenten Selenski, dem ukrainischen Kanzleichef Jermak, dem ukrainischen Innenminister Klymenko, dem ukrainischen Aussenminister Sybiha, dem deutschen Bundeskanzler Scholz und dem französischen Präsidenten Macron fast ausschliesslich Personen zitiert, welche völlig einseitig und voreingenommen die Position der Ukraine vertreten. Neben diesen Stimmen werden nur noch jene des Kremlsprechers Peskow und jene von US-Präsident Trump erwähnt, nicht aber im Sinne einer Gegendarstellung. Peskow wird nur im Zusammenhang mit den laufenden Verhandlungen zwischen Russland und den USA zitiert, und von Trump wird nur die Aussage erwähnt, dass sich Russland „bewegen muss“, seien in diesem „schrecklichen und sinnlosen Krieg“ doch bereits „zu viele Menschen gestorben, Tausende pro Woche“. Im Artikel über die israelischen Luftangriffe hingegen wird mit einem israelischen Militärsprecher und anderen Wortführern der israelischen Armee ausschliesslich die israelische Position aufgezeigt, es fehlt gänzlich an Aussagen von Personen bzw. Organisationen, welche dieser Militäraktion oder allgemein der offiziellen israelischen Kriegspolitik kritisch gegenüber stehen oder sie sogar verurteilen. Selbst der Direktor des betroffenen Krankenhauskomplexes wird ausschliesslich mit der Aussage zitiert, das Personal sei „vorab gewarnt und zur Evakuierung des Spitals aufgefordert worden“, kein Wort über das unermessliche Leiden, das den Patientinnen und Patienten des Spitals angetan worden war, kein Zitat vom Internationalen Roten Kreuz, von Amnesty International oder von einer anderen NGO, welche militärische Anschläge auf Spitäler grundsätzlich als Kriegsverbrechen bezeichnen.
Neuntens die Rechtfertigung der Taten. Im Artikel über die Attacke in Sumy finden wir ausschliesslich die Aussage von Selenski, wonach es Russland bei diesem Anschlag nur darum gegangen sei, „eine möglichst hohe Anzahl an Zivilisten zu treffen“. Die Position Russlands, wonach der Angriff einem Treffen ukrainischer Offiziere gegolten habe und die Zivilbevölkerung bloss als „Schutzschild“ missbraucht worden sei, wird nicht erwähnt. Es mag ja legitim sein, diese Behauptung Russlands in Frage zu stellen, jedoch müsste sie im Rahmen einer einigermassen objektiven Berichterstattung zumindest Erwähnung finden. Auch das Zitat des Kreml-Sprechers Peskow, wonach die russische Armee ausschliesslich „militärische und mit dem Militär in Verbindung stehende Ziele angreift“, dürfte bei aller Skepsis gegenüber einer solchen Aussage doch zumindest Erwähnung finden, alles andere kann man nicht anders bezeichnen denn als Zensur und Bevormundung der Leserschaft. Sogar Wolodymyr Artjuch, Gouverneur des Gebiets Sumy, hat gemäss ARD inzwischen bestätigt, in der Stadt habe zur Zeit des russischen Angriffs eine Versammlung hochrangiger Militärs stattgefunden. Artjuch selber distanzierte sich vom Entscheid, dieses Treffen in Sumy abzuhalten. Es sei nicht seine Initiative gewesen, er sei nur eingeladen worden, über den Initiator des Treffens könne er keine Angaben machen, das sei „ein anderes Thema“. Kein Wort davon in der angeblich so neutralen und objektiven Schweizer Tageszeitung. Höchst bezeichnend ist auch, dass die identische Aussage, wonach Zivilpersonen häufig als Schutzschilde gegen militärische Attacken missbraucht würden, die man der russischen Seite offensichtlich nicht abnimmt, von den gleichen westlichen Medien, wenn sie von der israelischen Seite im Zusammenhang mit Angriffen auf die Hamas ins Feld geführt wird, kaum je kritisch hinterfragt wird. Bezeichnenderweise findet man daher im Artikel über die israelische Militäraktion im Gaza-Streifen die Aussage der israelischen Armeeführung, wonach die Luftschläge einer „Kommandozentrale der Hamas innerhalb des Spitals“ gegolten hätten, von der aus „die militant-islamistische Gruppe Anschläge auf israelische Zivilpersonen und Soldaten geplant“ habe. Das identische Argument also, dass der jeweilige Anschlag gar nicht Zivilpersonen, sondern einem militärischen Ziel gedient hätte, wird im Falle von Sumy nicht einmal erwähnt, im Falle der israelischen Luftschläge jedoch kommentarlos übernommen. Einseitiger und tendenziöser geht es nun wirklich nicht mehr.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich, wie das Beispiel des „St. Galler Tagblatts“ vom 14. April 2025 exemplarisch zeigt, die westliche Berichterstattung über zwei der zurzeit brisantesten Konfliktherde, die Ukraine und den Gaza-Streifen, durch alles andere auszeichnet als durch Objektivität und Ausgewogenheit. Im Gegenteil: Die meisten Politiker wie auch die allermeisten Medienschaffenden scheinen schon zum Vornherein auf ihrer Nase eine Brille sitzen zu haben, durch die sie die eine Seite nur in positivem Licht sehen, die andere nur in negativem. In diesem Licht braucht Putin bloss zwei Raketen abzuschiessen und 32 Menschen zu töten und schon ist das ein weiterer Beweis dafür, dass er nichts anderes ist als der Inbegriff des absolut „Bösen“, vergleichbar bestenfalls mit Hitler oder gar dem Teufel. Gleichzeitig kann der israelische Ministerpräsident Netanyahu Zehntausende von Kindern abschlachten und gilt dennoch nach wie vor als der Repräsentant der „einzigen Demokratie im Nahen Osten“. Gemäss Zählungen des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte OHCHR hat der Ukrainekrieg bis jetzt innerhalb von drei Jahren 12’910 zivile Todesopfer gefordert, im Gazastreifen wurden hingegen innerhalb von eineinhalb Jahren bereits über 70’000 Menschen getötet, einigen Schätzungen zufolge schon gegen 100’000, 70 Prozent davon Frauen und Kinder, über 10’000 noch unter den Trümmern verschüttete, noch nicht gefundene Tote nicht einmal mitgezählt. Was im Klartext nichts anderes heisst, als dass im Gaza-Streifen durchschnittlich täglich fast 20 Mal mehr Zivilpersonen getötet werden als in der Ukraine. Doch während auf der einen Seite stets vom russischen „Angriffskrieg“ gegen die Ukraine die Rede ist und die gesamte Vorgeschichte des Konflikts mit der NATO-Osterweiterung und sämtlichen weiteren Provokationen durch den Westen systematisch ausgeblendet wird, spricht man im Zusammenhang mit dem von Israel an den palästinensischen Männern, Frauen und Kindern begangenen Völkermord als einem von Israel rechtmässig in Anspruch genommenen „Recht auf Verteidigung“. Wobei auch der Begriff des „Terrorismus“ stets nur auf nichtstaatliche Rebellen oder Widerstandskämpfer angewendet wird, nie aber auf Staaten wie Israel oder die USA, welche zweifellos für die in ihrem Ausmass mit nichts anderem zu vergleichenden schwersten Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen der jüngeren Geschichte verantwortlich sind – rufe man sich doch nur kurz die über 40 seit 1945 von den USA angezettelten, grösstenteils völkerrechtswidrigen Kriege und Militäraktionen in Erinnerungen, mit insgesamt 50 Millionen Toten und 500 Millionen Verletzten, von Vietnam, Laos, Honduras, El Salvador über Jugoslawien bis zu Afghanistan. Libyen und dem Irak.
Ganz abgesehen davon, dass sich die Zustände in der Ukraine und jene im Gazastreifen ohnehin auch nicht annähernd miteinander vergleichen lassen. Während die Ukraine immer noch über eine weitgehend intakte Infrastruktur, ein funktionierendes Gesundheitswesen, einigermassen sichere Strassenverbindungen verfügt und niemand hungern muss, ist der Gazastreifen, wo inzwischen etwa drei Viertel aller Häuser dem Erdboden gleichgemacht wurden, das gesamte Gesundheitssystem zusammengebrochen ist und Millionen von Menschen vom Hungertod bedroht sind, im Vergleich dazu die wahre Hölle. Aber auch das ist noch nicht genug. Als Folge einer total verzerrten und die Realität geradezu ins Gegenteil verdrehenden Propaganda ist es den westlichen Machthabern gelungen, für die Ukraine zivile und militärische Unterstützung in Milliardenhöhe aufzubringen, inklusive Zusicherungen, nach dem Krieg alles wieder neu aufzubauen. Während auf der anderen Seite sogar die Schweiz als eines der reichsten Länder der Welt die finanzielle Unterstützung für das palästinensische Hilfswerk UNRWA um Haaresbreite gestrichen und damit den Hungertod von Millionen von Menschen bewusst in Kauf genommen hätte. Und US-Präsident Trump unter betretenem Schweigen des gesamten Westens die geradezu an Hybris grenzende Vision kundtat, sämtliche Palästinenserinnen und Palästinenser für immer aus ihrer Heimat zu vertreiben und an deren Stelle eine Riviera mit Strassencafés, Vergnügungslokalen, Spezialitätenrestaurants und Luxushotels für die Reichsten aus aller Welt aufzubauen.
Zufällig findet sich auf der gleichen Seite 7 des „St. Galler Tagblatts“ auch ein Artikel zu den bevorstehenden Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Trump drängt auf ein Abkommen, um den Iran an der Entwicklung von Atomwaffen zu hindern. Die iranische Führung beteuert zwar, die Atomenergie nur für friedliche Zwecke nutzen zu wollen, dennoch hat Trump unlängst mit der Bombardierung des Iran gedroht, sollte es zu keinem Einlenken kommen. Was – wieder werden wir ganz leise und sanft manipuliert – mit keinem Wort erwähnt wird: Dass sich Israel bereits seit 1967 im Besitz von Atomwaffen befindet. Aber das ist halt eben etwas ganz anderes. Israel gehört ja zu den Guten und darf das, der Iran aber gehört zu der sogenannten „Achse des Bösen“, zu welcher der Westen auch Russland zählt, darf das deshalb eben nicht und müsste sogar damit rechnen, zur Strafe dafür dem Erdboden gleich gemacht zu werden. Vielleicht ja sogar noch mithilfe Israels. Man stelle sich mal das Gegenteil vor: Putin würde Israel auffordern, seine Atomwaffen zu verschrotten, andernfalls würde er erwägen, das Land in Schutt und Asche zu legen…
Muss der Westen seine Lügengebäude wohl deshalb mit allen Mitteln dermassen weit in die Höhe bauen und dermassen systematisch seine Bürgerinnen und Bürger manipulieren und blenden, weil die Wahrheit, wenn sie denn ans Licht käme, so unerträglich wäre, dass niemand vorausahnen kann, was für gesellschaftliche und politische Umwälzungen bis hin zum Zusammenbruch der gesamten kapitalistisch-imperialistischen „Weltordnung“ dies zur Folge haben könnte?
Diesen Artikel habe ich am 20. April 2025 auch an die Chefredaktion des „St. Galler Tagblatts“ geschickt, ergänzt mit der Frage, welche Richtlinien bezüglich Ausgewogenheit, journalistischer Sorgfaltspflicht und Objektivität der redaktionellen Arbeit zugrunde liegen und mit welchen Instrumenten die Einhaltung solcher Richtlinien überprüft werde. Ich habe nie eine Antwort bekommen.
(Ergänzung am 22. 4.25: Seltene Ausnahmen gibt es noch. Sie zeigen erst recht, wie einseitig und manipulativ die weitaus überwiegende Mehrzahl der Mainstreammedien „informiert“. So las und hörte ich in Bezug auf die von Putin über die Ostertage 2025 ausgerufene Waffenruhe in der Ukraine in sämtlichen Medien nur immer, es habe sich bloss um einen „Propagandatrick“ gehandelt und Russland selber habe sich überhaupt nicht an diese Waffenruhe gehalten, sondern sie im Gegenteil dazu benutzt, seine Angriffe unvermindert fortzusetzen. Bis ich auf diese Meldung im „Tagesanzeiger“ vom 22.4. stiess: „Moskau beschuldigte die Ukraine, die Pause, die 30 Stunden hätte dauern sollen, 4900-mal verletzt zu haben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr erklärte seinerseits, die Russen hätten die Pause 2935-mal verletzt.“ Manchmal findet die Wahrheit auch in der dicksten Mauer der versuchten Manipulation noch ein Schlupfloch…)
(Kommentar von Walter Tauber, Journalist und Filmemacher, am 22.4.25: „Danke für die tolle Analyse der beiden Zeitungsartikel im „St. Galler Tagblatt“ vom 14. April 2025. So etwas sollte man flächendeckend zu allen Leitmedien und ständig machen – aber wer hat dazu die Zeit? Vielleicht als Kollektiv?“)
(„Die wichtigsten Soldaten moderner Kriege sind die Journalisten. Es gibt keinen Krieg ohne eine arglistig täuschende Regierung und einen auf ihre Weisung lügnerisch und gewalttätig werdenden Staatsapparat. Und dieser braucht zu seinem Schutz eine verblendete Öffentlichkeit, die nur sieht, was sie sehen kann, ohne die Abschaffung der Zivilisation zu bemerken. Wo Krieg herrscht, da sind vorher Journalisten Soldaten geworden.“ Michael Andrick, Philosoph, Berliner Zeitung im Mai 2025)
(Ergänzung am 14. Juni 2025: Täglich findet man in den Medien Beispiele für tendenziöse Berichterstattung, so zum Beispiel im Gratisblatt „20minuten“ vom 24.6. Grosse Schlagzeile auf der Frontseite ganz oben: Schweizer Rekruten „bereit für die Front“. Einstimmen ins allgemeine Kriegsgeheul, wie es sich für ein richtig Mainstreammedium gehört. Liest man allerdings den unterhalb der Schlagzeile stehenden Text, findet man dort genau das Gegenteil, nämlich den Satz: „Lust auf Krieg hat keiner, das machen viele der jungen Männer klar.“)
Peter Sutter, 18. April 2025

Lieber Beat
Im „St. Galler Tagblatt“ vom 23. Januar 2025 äusserst du dich zur Schweizer Asylpolitik 2024 wie folgt: „Wir sind in verschiedenen Bereichen den europäischen Ländern deutlich voraus. Die Asylzahlen waren im September 40 Prozent tiefer als im September 2023. Die Zahl der Pendenzen sinkt. Wir haben 2024 25 Prozent von ihnen abbauen können. Auch die Rückkehrzahlen steigen, mit einer Rückführungsquote von annähernd 60 Prozent steht die Schweiz in Europa an der Spitze. Das SEM macht eine hervorragende Arbeit. Wir sind auf dem richtigen Weg. Doch wir sind noch nicht zufrieden. Der immer noch zu grosse Pendenzenberg muss rascher abgebaut werden.“
Aus meiner Sicht sind solche Aussagen zynisch und der humanitären Tradition der Sozialdemokratie unwürdig. Als Mitglied der SP seit 40 Jahren ist das wieder einmal so ein Moment, an dem ich mir ernsthaft überlege, ob ich weiterhin noch Mitglied einer Partei sein kann, die einen Bundesrat stellt, der sich mit solchen Worten öffentlich äussert.
Ich habe innerhalb der vergangenen neun Monate am Beispiel von zwei asylsuchenden Personen hautnah erlebt, wie sich die aktuelle schweizerische Asylpolitik auf die unmittelbar davon Betroffenen auswirkt. Ich fasse meine Erfahrungen im Folgenden kurz zusammen. Die Namen sind geändert.
Halime ist eine 25jährige Afghanin. Ihre Leidensgeschichte beginnt mit Zwangsverheiratung im Alter von 16 Jahren und schweren Misshandlungen durch ihren Ex-Mann, geht weiter mit der Flucht über den Iran und die Türkei mit zahlreichen weiteren Gewalterfahrungen und endet in Griechenland, wo sie den Flüchtlingsschutzstatus und damit das Bleiberecht erhält. Da die Verhältnisse für Flüchtlinge in Griechenland bekanntermassen katastrophal sind, nach 30 Tagen jegliche staatliche Unterstützung erlischt und viele Flüchtlinge in Elend und Obdachlosigkeit landen, wo sie weiteren unzumutbaren Gewalterfahrungen ausgesetzt sind, ersucht Halime in der Schweiz um Asyl, insbesondere auch deshalb, weil sie befürchtet, ihr Ex-Mann oder Verwandte von ihm könnten sich ebenfalls bereits in Griechenland aufhalten und ihr nach dem Leben trachten. Schwer traumatisierte junge Frauen aus Afghanistan, die alleine unterwegs sind, erhielten bis vor etwa zwei Jahren in aller Regel in der Schweiz eine F-Aufenthaltsbewilligung, auch wenn sie über ein Bleiberecht in Griechenland verfügten. Diese Praxis wurde in den vergangenen zwei Jahren drastisch verschärft. Halimes Asylgesuch wird am 4. Oktober 2024 mit Bezugnahme auf das Dublin-Abkommen trotz der schweren Traumatisierung der jungen Frau und ihrer Todesängste vom SEM abgelehnt.
Im Gegensatz zu deiner Aussage, das SEM leiste „hervorragende“ Arbeit, ist das Argumentarium, mit dem Halimes Asylgesuch abgelehnt wird, an unzulässigen und widersprüchlichen Aussagen nicht zu übertreffen. Jede Aussage von Halime, auch wenn sie sie noch so glaubwürdig und überzeugend darlegt, wird mit der Begründung zurückgewiesen, sie könne sie „nicht beweisen“. Doch wie soll sie, um nur ein Beispiel zu nennen, die von ihrem Ex-Mann ausgesprochenen Morddrohungen beweisen, wenn ihr das Handy, wo die entsprechenden Nachrichten gespeichert waren, an der türkisch-griechischen Grenze gewaltsam entrissen wurde? Zudem nimmt das Argumentarium mehrfach Bezug auf eine Aussage des Bundesrates aus dem Jahre 2008 (!), wonach Griechenland ein „sicherer Drittstaat“ sei, was von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe und anderen NGOs mit zahlreichen Studien in der Zwischenzeit mehrfach widerlegt wurde. Auch erscheint die schwere Traumatisierung der schwergeprüften Frau an keiner einzigen Stelle des Argumentariums als mögliche Begründung für ein Bleiberecht in der Schweiz. Im Gegenteil: Mehrfach wird betont, es handle sich bei Halime um eine „junge, gesunde Frau“, die „keinerlei Probleme“ haben werde, in Griechenland eine Unterkunft und einen Job zu finden – obwohl allgemein bekannt ist, dass die Arbeitslosigkeit in Griechenland zurzeit bei etwa 12 Prozent liegt und eine Frau, die weder über eine Berufsausbildung noch über Kenntnisse der Landessprache verfügt, bestenfalls die Chance auf einen Job in der Schattenwirtschaft hat, mit allen damit verbundenen Gefahren von Ausbeutung und Missbrauch.
Besonders stossend ist, dass sich die Anwältin, die Halime zugeteilt wurde, keinen Deut um das Schicksal ihrer Mandantin kümmert, obwohl das doch eigentlich ihre Aufgabe wäre. Auch habe ich mir sagen lassen, dass die Bearbeitung von Asylgesuchen stark vom jeweiligen Kanton abhängt, der den Fall führt, und ebenso stark von den jeweils zuständigen Mitarbeitenden des SEM. Eine reine Lotterie mit unter Umständen geradezu tödlichen Folgen.
Auch eine von mir unterstützte Beschwerde Halimes gegen den SEM-Entscheid, fristgerecht eingereicht ans Bundesgericht, wird abgewiesen. Anstelle einer erhofften seriösen Neubeurteilung übernimmt das Bundesverwaltungsgericht nahezu wortwörtlich die Argumentation des SEM. Und so muss Halime trotz bedenklichen gesundheitlichen Zustands mit hohem Fieber, Magenkrämpfen und nach mehreren schlaflosen Nächten infolge ihrer Ängste und Traumatisierungen und ohne jegliche medizinische, psychologische und finanzielle Unterstützung anfangs November 2024 die Schweiz verlassen. Hätte sie ihr Asylgesuch zwei Jahre früher eingereicht, so wurde mir von mehreren Fachpersonen, die im Asylwesen tätig sind, unabhängig voneinander bestätigt, wäre es höchstwahrscheinlich positiv beantwortet worden – während früherer Jahre fanden aus der Schweiz sogar überhaupt keine Rückschaffungen nach Griechenland statt. So massiv hat sich die schweizerische Asylpolitik in kurzer Zeit auf Druck der Rechtsparteien, insbesondere der SVP, verschärft. Und dies nicht nur in diesem Aspekt. Über fünf Mal ist die schweizerische Asylpolitik auf Druck der SVP und einer systematisch von ihr heraufbeschworenen fremdenfeindlichen Stimmung in der Bevölkerung im Verlaufe der vergangenen zehn Jahre immer restriktiver geworden.
Das zweite Beispiel ist eine afrikanische Flüchtlingsfamilie, die aufgrund ihres negativen, aus verschiedenen Gründen noch nicht vollzogenen Asylentscheids seit acht Jahren täglich mit der Angst leben muss, von einem Tag auf den anderen gewaltsam ausgeschafft zu werden. Alle paar Tage bekommen sie mit, wie Asylsuchende frühmorgens von der Polizei aus ihren Betten geholt und in Handschellen abgeführt werden. Die 13jährige Chantal ist inzwischen so schwer traumatisiert, dass sie nächtelang wach und schweissgebadet in ihrem Bett liegt und sich immer wieder mit dem Gedanken herumschlägt, sich das Leben zu nehmen.
2024 wurden 7205 Asylsuchende aus der Schweiz in ihre Herkunftsländer zurückgeschafft, zwei Drittel von ihnen zwangsweise, gegen ihren Willen, täglich also rund zwölf Menschen, in Handschellen oder Ganzkörperfesselung, als handle es sich um Schwerverbrecherinnen und Schwerverbrecher.
Mir ist klar, dass die Schweiz nicht sämtliche Personen aufnehmen kann, die hier Asyl suchen. Aber ist eines der reichsten Länder der Welt tatsächlich mit durchschnittlich nicht einmal einem einzigen anerkannten Flüchtling pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner schon am Limit? Wo ist die Solidarität mit anderen Ländern und Weltregionen? In Griechenland, wohin Menschen zurückgeschafft werden und das selbst mit massiven sozialen und wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hat, gibt es pro 100 Einheimische doppelt so viele Flüchtlinge wie in der Schweiz. Im Libanon kommt auf jede einheimische Person ein Flüchtling. Bangladesch musste innerhalb eines einzigen Jahrs mit einer ganzen Million Flüchtlingen aus Myanmar fertigwerden. In Afrika gibt es Millionen von Binnenflüchtlingen. Und wir sind schon mit einem einzigen Flüchtling pro 100 Einheimische überfordert?
Dazu kommt, dass durch die grosszügige Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen der Druck, aus anderen Ländern noch weniger Flüchtlinge aufzunehmen, zusätzlich verstärkt wurde. Weshalb werden Flüchtlinge so unterschiedlich behandelt je nach dem Land, wo sie herkommen? Sind Menschenrechte nicht universell, gelten sie nicht für alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion?
„Wenn das Unrecht zu Recht wird“, sagte Bertolt Brecht, „dann wird Widerstand zur Pflicht.“ Wie lange wollen wir als SP uns noch von der SVP in eine Richtung hetzen lassen, mit der wir uns von den ursprünglichen Idealen der Sozialdemokratie immer weiter entfernen? Wie lange noch lassen wir uns instrumentalisieren und lassen es zu, die schmutzige Arbeit für andere zu erledigen, die sich, wenn es drauf und dran kommt, vornehm zurücklehnen und so tun, als hätten sich nichts damit zu tun? Wann endlich gelingt es uns, die Bevölkerung darüber aufzuklären, dass nicht die „Linken“ schuld sind an den globalen Flüchtlingsbewegungen, sondern das kapitalistische Weltwirtschaftssystem, das im Verlaufe der vergangenen 500 Jahre eine immer tiefere Kluft aufgerissen hat zwischen armen, ausgebeuteten Weltregionen und reichen, von dieser Ausbeutung profitierenden?
Hätte man auf die Linken gehört – etwa auf die Forderung nach Beibehaltung des Botschaftsasyls, gerechte Preise für Rohstoffe, Konzernverantwortung, ressourcenschonende Wirtschaft, faire Handelsbeziehungen zwischen Norden und Süden, etc. –, dann hätten wir heute nicht mehr, sondern viel weniger Flüchtlinge, weil nämlich kein Mensch einen Grund hat, seine Heimat zu verlassen, wenn er unter menschenwürdigen Bedingungen dort leben kann.
„… wird der Widerstand zur Pflicht…“ Müsste ein SP-Justizminister als Repräsentant der Sozialdemokratie, der sozialen Gerechtigkeit und der Menschenwürde nicht aufstehen und öffentlich erklären, dass sein Gewissen es nicht länger zulasse, dieses grausame Spiel mitzuspielen? Wieso brüstet man sich sogar noch damit, innerhalb eines Jahres mehr Flüchtlinge ausgeschafft zu haben als in allen Jahren zuvor? Erringt man europäische Spitzenwerte neuerdings dadurch, dass man möglichst viele Träume von einem schöneren Leben zerstört? Kann man sich mit Humanität, Menschenfreundlichkeit und Gastfreundschaft heute nicht mehr profilieren, sondern nur noch mit möglichst hohen Zahlen abgewiesener Flüchtlinge?
Die SVP hat es geschafft, uns durch permanentes Schüren von Feindbildern und von Fremdenhass und vom Aufbauschen einzelner von Asylsuchenden begangener Delikte einzureden, wir würden von Flüchtlingen „bedroht“, „überflutet“ und das „Boot“ sei längst schon „voll“. Zu dieser von Hass und Fremdenfeindlichkeit geprägten Stimmungswelle, die mittlerweile schon geradezu zur kaum mehr hinterfragten gesellschaftlichen „Normalität“ geworden ist, braucht es dringendst eine mindestens so starke Gegenbewegung. Die Ausrede, die anderen europäischen Länder betrieben ja genau die gleiche oder sogar noch härtere Flüchtlingspolitik, kann das begangene Unrecht nicht rechtfertigen. Im Gegenteil: Mit ihrer humanitären Tradition wäre die Schweiz sogar in ganz besonderem Ausmass moralisch verpflichtet, an die Werte von Mitmenschlichkeit und Solidarität zu erinnern und sich für ihre Bewahrung tatkräftig einzusetzen, vielleicht sogar als Vorbild für andere. Sonst wird die Gefahr immer grösser, dass über Jahrzehnte hart erarbeitete Werthaltungen scheibchenweise nach und nach immer mehr verloren gehen, bis am Ende nichts mehr davon übrig bleibt.
Das Mindeste wäre, dass der Bundesrat seine 2008 gemachte und seither x-fach widerlegte Aussage, Griechenland sei ein „sicherer Drittstaat“, endlich widerrufen würde. Damit das SEM wenigstens dieses Argument, um Flüchtlinge ohne ernsthafte individuelle Überprüfung ihrer Gesuche möglichst rasch abzuschieben, nicht mehr verwenden könnte.
Es geht mir nicht darum, jemanden an den Pranger zu stellen. Aber die Gefahr ist gross, dass man, wenn man einfach seinen „Job“ macht, dadurch möglicherweise – ohne es eigentlich zu wollen – Unrecht begeht. Ich finde, darüber muss man mindestens offen und ehrlich diskutieren, gerade innerhalb einer politischen Partei, bei der doch die menschlichen Werte an oberster Stelle stehen müssten.
Eine Kopie dieses Schreibens ging am 15. April 2025 an das Zentralsekretariat der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz.
Am 1. Mai 2025 erhielt ich folgende Antwort von Bundesrat Beat Jans:
Lieber Peter, ich danke dir für deinen Brief vom 15. April 2025. Deine Zeilen habe ich mit Interesse gelesen. Ich kann nachvollziehen, dass solche Einzelfälle berühren und aufwühlen… Ich kann dir versichern: Auch ich will ein menschliches Asylsystem. Letztlich geht es immer um Menschen – wer Anspruch auf Schutz hat, soll bei uns Schutz bekommen. Wir halten uns dabei an unsere internationalen Verpflichtungen wie die Genfer Flüchtlingskonvention. Für diese Grundwerte stehe ich ein. Gleichzeitig stellt das hohe Migrationsaufkommen grosse Anforderungen an die Schweiz – ebenso wie an viele andere europäische Staaten. Unser Asylsystem muss deshalb sowohl fair als auch glaubwürdig bleiben… Jeder Entscheid wird im rechtlich vorgegebenen Rahmen individuell geprüft, kann angefochten und von unabhängigen Gerichten beurteilt werden. Die von dir kritisierte Praxis der Rückführungen, insbesondere im Rahmen der Dublin-Verordnungen, beruht auf internationalen Abkommen, die die Schweiz zusammen mit anderen europäischen Staaten eingegangen ist. Diese Abkommen sind nicht politisches Kalkül, sondern Teil eines solidarischen und regelbasierten Systems, das sowohl Schutzbedürftigen als auch den Aufnahmestaaten Verlässlichkeit gibt. Gerade auch in Griechenland erfolgt die Rückführung nur unter der Voraussetzung, dass die dortige Betreuung gewährleistet ist… Dass das SEM Fortschritte beim Abbau der Pendenzen und bei den Rückführungen erzielen konnte, bedeutet nicht, dass der humanitäre Ansatz verloren gegangen wäre. Es zeigt vielmehr, dass Verfahren effizienter gestaltet und unzumutbare Wartezeiten für Asylsuchende verkürzt werden können. Der Schutz von besonders vulnerablen Personen bleibt dazu ein zentrales Anliegen. Wo Härtefälle bestehen, gibt es zudem die Möglichkeit von humanitären Aufenthaltsbewilligungen… Die Asylpolitik ist ein laufender Balanceakt zwischen Humanität und Rechtsstaatlichkeit. Ich nehme deine Kritik ernst, ebenso deine Ermahnung, die humanitären Werte nicht aus den Augen zu verlieren. Diese Werte bleiben Grundlage unseres Handelns.
„Gibt es Hoffnung für Syrien?“, dies das Thema des Buchser Montagsgesprächs vom 14. April. Zunächst berichteten Bahira* und Afsan* über ihr früheres Leben in Syrien und die Gründe für die Flucht. Bahira stammt aus Damaskus. Zwei Jahre nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs im März 2011 flüchtete die Familie in den Libanon, wo sie eineinhalb Jahre lang unter misslichsten Bedingungen lebten, bevor sie im Rahmen eines UN-Hilfsprogramms in die Schweiz einreisen durften. Afsan ist Kurde. Bei der Flucht war er erst zwei Jahre alt. Die Kurden, so Afsan, seien von allen in Syrien lebenden Volksgruppen die am meisten benachteiligte und unterdrückte.
Sowohl Bahira wie auch Afsan hätten sich über den Sturz Assads gefreut, hätten sie darin doch endlich die Chance zu einem demokratischen Neubeginn ihrer Heimat gesehen. Doch sei es noch schwierig abzuschätzen, ob unter den neuen, ursprünglich aus islamistischen Extremisten hervorgegangenen Machthabern der Aufbau einer demokratischen Gesellschaft möglich sei. Befürchtungen gäbe es vor allem in Bezug auf die Situation der Frauen, denn es gäbe innerhalb der neuen Machthaber leider Tendenzen, die Rechte der Frauen massiv einzuschränken.
Entscheidend für die zukünftige Entwicklung Syriens werde auch das Verhalten all jener Länder sein, die sich immer und immer wieder in die inneren Angelegenheiten Syriens eingemischt hätten, so etwa die Türkei, die danach strebe, im Nahen Osten eine bedeutende Regionalmacht zu sein, oder Israel, das unmittelbar nach dem Sturz Assads fast die gesamte militärische Infrastruktur Syriens zerstört und mittels einer völkerrechtswidrigen geschaffenen „Pufferzone“ im Norden des Landes den Zugang vieler Syrer und Syrerinnen zu ihren eigenen Wohngebieten verunmöglicht hat.
Die Behauptung eines Diskussionsteilnehmers, Islam und Demokratie seien unvereinbar, löste eine längere Debatte aus. Dieser Behauptung widersprochen wurde mit dem Argument, es gäbe in jeder Religionsgemeinschaft nach Macht strebende Einzelne oder Gruppen, welche die Religion für ihre eigenen Interessen missbrauchten. Auch im Christentum hätte es solche Tendenzen gegeben, zum Beispiel zur Zeit der Kreuzzüge, als die Christen „im Namen Gottes“ gegen die Araber in den Krieg zogen, oder sogar in neuester Zeit, als sich US-Präsident George W. Bush bei seinem völkerrechtswidrigen Angriff auf den Irak auf das „Wort Gottes“ berufen hätte. Dies hätte aber nichts zu tun mit den ursprünglichen Grundwerten der Religionen, die sich in ihren ethischen Grundwerten erstaunlich ähnlich seien.
Ein Bibelzitat, in dem von einer zukünftigen weltweiten Friedensordnung die Rede ist, setzte den hoffnungsvollen Schlusspunkt unter eine Diskussion, die trotz teilweise grossen Meinungsverschiedenheiten letztlich doch erkennen liess, dass wohl die überwiegende Mehrheit der Menschen, unabhängig von Religionen und Nationalitäten, durch die gemeinsame Sehnsucht nach einer friedlichen und gerechten Welt miteinander verbunden sind.
* Namen geändert
Peter Sutter, 17. April 2025
Schon das Titelbild des neuen Buches von Frank Urbaniok („Schattenseiten der Migration“) sagt alles: Zu sehen ist ein Messer – obwohl Urbaniok zweifellos weiss, dass nur 1,2 Prozent der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung Straftaten begehen und bei den Asylsuchenden die entsprechende Rate bei 4,4 Prozent liegt. Aber wie gewisse politische Hardliner scheint auch Urbaniok lieber den Fokus auf die kleine Minderheit Straffälliger zu richten statt auf die überwiegende Mehrheit derer, die sich nicht des geringsten Vergehens schuldig machen.
Dass der Anteil straffälliger Personen bei Asylsuchenden über dem gesamtschweizerischen Durchschnitt liegt, hat weniger mit der jeweiligen Nationalität zu tun, als damit, dass in diesem Bevölkerungssegment der Anteil junger, alleinstehender Männer mit schlechten Zukunftsperspektiven überproportional hoch ist. Auch bei den Schweizern ist dieses Bevölkerungssegment überdurchschnittlich delinquent. Es kommt dazu, dass die meisten Asylsuchenden in ihrer früheren Heimat und während der Flucht zahlreichen Gewalterfahrungen ausgesetzt waren, was mit ein Grund dafür sein kann, dass sie sich selber gegenüber anderen gewalttätig verhalten.
Mit dem auch von Urbaniok häufig verwendeten Begriff der „Ausländerkriminalität“ wird suggeriert, dass jeder Ausländer ein potentieller Krimineller ist, obwohl dies nur für eine verschwindend kleine Minderheit zutrifft. Nähme man aber nicht die Nationalität zum Massstab, sondern das Geschlecht, dann wären die Vergleichszahlen unvergleichlich viel dramatischer. Männer begehen nämlich nicht doppelt oder drei Mal, sondern sage und schreibe 189 Mal häufiger schwere Straftaten als Frauen, und dies über alle Nationalitäten hinweg. Dennoch spricht seltsamerweise niemand von „Männerkriminalität“. Und auch bei Straftaten wie Steuerhinterziehung, mit der dem schweizerischen Fiskus jährlich über 65 Milliarden Franken entzogen werden, kommt niemandem in den Sinn, von „Inländerkriminalität“ zu sprechen.
Am schlimmsten aber ist, dass Urbaniok ganze Nationalitäten pauschal in Sippenhaft nimmt. So weist er darauf hin, dass Menschen aus Kamerun in der Schweiz am häufigsten straffällig sind, ohne zu erwähnen, dass in fast keinem anderen Land die Menschenrechte dermassen mit Füssen getreten werden und Folter sowie Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren dort an der Tagesordnung sind.
Urbaniok geht sogar noch weiter und fordert, dass aus „gewaltbereiten“ Ländern wie Afghanistan zukünftig weniger Flüchtlinge aufgenommen werden sollten als bisher. Was nichts anderes bedeuten würde, als dass ausgerechnet für Frauen aus Afghanistan, die zu den weltweit am meisten von Gewalt betroffenen Menschen gehören, das Recht auf Asyl in der Schweiz erschwert oder gar verunmöglicht werden sollte.
Ich frage mich, mit welcher Absicht Urbaniok dieses Buch wohl geschrieben hat. Zu einer sachlichen und fundierten Diskussion trägt es gewiss nicht das Geringste bei, sondern zementiert nur bereits vorhandene Vorurteile und Schuldzuweisungen.
Peter Sutter, 16. April 2025
Von einem „Handelskrieg“ mit unabsehbaren Folgen schreibt die „Sonntagszeitung“ vom 13. April 2025 im Zusammenhang mit Donald Trumps aggressiver und rücksichtsloser Zollpolitik. Im Interview mit der Unternehmerin Magdalena Martullo-Blocher ist die Rede von einbrechenden Finanzmärkten, unterbrochenen Lieferketten und einem drohenden Zusammenbruch der gesamten Weltkonjunktur.
Erstaunlich ist die grosse Empörung über die jüngsten Ereignisse. Als wäre zuvor alles friedlich und problemlos gewesen. Dabei ist kapitalistische Wirtschaftspolitik doch seit eh und je nichts anderes als eine andere Form von Krieg. Nur war es vorher nicht so augenfällig und offensichtlich. Indem Trump alles dermassen auf die Spitze treibt, öffnet er nun sozusagen auch noch den letzten gutgläubigen Verfechtern einer möglichst „freien“ Marktwirtschaft die Augen. Einer Wirtschaftsweise, die noch nie etwas anderes war als eine möglichst raffinierte Ausbeutung der Armen durch die Reichen, der Agrarländer durch die Industrieländer, des Südens durch den Norden, der Natur durch die Menschen, der Arbeit durch das Kapital.
Kapitalistische Wirtschaftspolitik ist nichts anderes als eine andere Art von Krieg. Eine scheinbar harmlosere, in Tat und Wahrheit aber mit noch viel zahlreicheren Opfern, als es „richtige“ Kriege fordern. Denken wir nur an die zurzeit weltweit wütenden rund 60 Kriege. Fast in jedem dieser Kriege geht es um Rohstoffe und Bodenschätze und darum, dass der gegenseitige Kampf um diese Güter mit immer härteren Bandagen ausgefochten werden muss, weil einerseits die Weltwirtschaft weiterhin ungebremst wachsen soll, anderseits aber die hierfür notwendigen Ressourcen gleichzeitig immer knapper werden. Oder denken wir daran, dass jeden Tag weltweit rund 15‘000 Kinder vor dem Erreichen ihres fünften Lebensjahrs sterben, weil sie nicht genug zu essen haben – nicht weil insgesamt zu wenig Nahrung vorhanden wäre, sondern nur, weil die Güter nicht dorthin wandern, wo sie am dringendsten gebraucht werden, sondern dorthin, wo sie möglichst gewinnbringend verkauft werden können. Nicht einmal alle Kriege weltweit zusammen fordern auch nur annähernd so viele Opfer wie die auf reine Profitmaximierung ausgerichtete Verteilung der vorhandenen Nahrungsmittel. Und all dies geschieht ganz still und heimlich und ohne dass es in der Öffentlichkeit auch nur ansatzweise jene Empörung auslösen würde, die sich zurzeit angesichts der „zerstörerischen“ Wirtschaftspolitik von Donald Trump manifestiert.
Aus einer kriegerischen Wirtschaftspolitik wird noch lange nicht eine friedliche, indem Zölle wieder auf ein „vernünftiges“ Mass hinunterschraubt, immer mehr bilaterale Freihandelsabkommen abgeschlossen oder dem globalen Warenfluss weniger Hindernisse in den Weg gestellt werden. Von einer wirklich friedlichen und gerechten Wirtschaftspolitik könnten wir erst dann sprechen, wenn ihre Grundlage nicht mehr das Recht der Stärkeren und der gegenseitige Konkurrenzkampf um Macht und Profite wäre, sondern das Wohlergehen aller durch eine möglichst gerechte Verteilung sämtlicher vorhandener Güter nicht nur für die heute lebenden, sondern auch alle zukünftigen Generationen.
Peter Sutter, 13. April 2025

„Es ist leichter, eine Lüge zu glauben, die man tausendmal hört, als die Wahrheit, die man nur einmal hört.“ Diese Worte des früheren US-Präsidenten Abraham Lincoln könnten in Anbetracht der zurzeit europaweit aufkommenden Kriegseuphorie aktueller nicht sein. Das tausendfach an allen Ecken und Enden verbreitete Bild vom „Aggressor Russland“ scheint sich bereits dermassen tief in den Köpfen der grossen Mehrheit der Bevölkerung verfestigt zu haben, dass gar nicht mehr darüber diskutiert wird, ob dieses Bild überhaupt stimmt, sondern nur noch darüber, was getan werden muss, um diesem „Aggressor“ möglichst rasch, wirkungsvoll und nachhaltig Einhalt zu gebieten, selbst auf die Gefahr hin, dass Abertausende von Menschen dies mit ihrem Leben bezahlen müssen.
Die Kriegstreiber scheinen, massiv unterstützt von den allermeisten Medien, derzeit auf Kurs zu sein. Doch liesse man sie gewähren, könnte es im schlimmsten Fall zu einer Katastrophe dermassen gigantischen Ausmasses kommen, dass wir uns deren Folgen gewiss auch nicht im Entferntesten vorzustellen vermögen. Um dies zu verhindern, muss alles getan werden, um die Kriegstreiber rechtzeitig zu stoppen. Oder, wie es der US-amerikanische Bürgerrechtskämpfer Martin Luther King sagte: „Jene, die den Frieden lieben, müssen sich ebenso wirkungsvoll organisieren wie jene, die den Krieg lieben.“
„Wenn wir uns Kriege ansehen, über die wir mehr wissen, zeigt sich, dass die Menschen vor allem wegen erfundener Geschichten gegeneinander kämpfen“, so der israelische Schriftsteller Yuval Noah Harari. Es bedarf daher, damit der Ukrainekonflikt nicht zu einem Flächenbrand mit unabsehbaren Folgen ausartet, an allererster Stelle der Entlarvung jener erfundenen Geschichte bzw. Lüge, wonach Russland der „Aggressor“ sei und der Westen sozusagen dessen „Opfer“, dem nichts anderes übrig bleibe, als sich gegen diesen „Aggressor“ unter Aufbietung aller seiner Kräfte zur Wehr zu setzen. Es gibt mehr als genug Argumente, um diese Lüge aufzudecken und die Frage aufzuwerfen, ob nicht sogar die genau gegenteilige Behauptung der tatsächlichen Wahrheit möglicherweise viel näher käme. Dies liesse sich dann sogar auch noch ganz simpel mit jener psychologischen Binsenweisheit erklären, wonach die eigene Denkensart und Verhaltensweise häufig in den vermeintlichen „Gegner“ hineinprojiziert wird und man ihm genau das zur Schuld legt, was man eigentlich ehrlicherweise sich selber zur Schuld legen müsste.
Hierzu im Folgenden einige Zitate, die dermassen selbstredend sind, dass sie keines weiteren Kommentars bedürfen.
„Um Amerikas Vormachtstellung in Eurasien zu sichern, braucht es die NATO-Osterweiterung. Eurasien ist das Schachbrett, auf dem sich auch in Zukunft der Kampf um die globale Vorherrschaft abspielen wird.“ (Zbignew Brzezinski, US-Politberater 1977-1981)
„Liebe Amerikaner, es ist mir ein Vergnügen, Ihnen heute mitzuteilen, dass ich ein Gesetz unterzeichnet habe, das Russland für vogelfrei erklärt. Wir beginnen mit der Bombardierung in fünf Minuten.“ (Am 11. August 1984 als „Witz“ gemeinte Aussage des damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan, der die Sowjetunion stets als das „Reich des Bösen“ zu bezeichnen pflegte und später einräumte, dieser „Witz“ hätte durchaus seiner Denkensart entsprochen)
„Die neue Weltordnung wird gegen Russland errichtet, auf den Ruinen Russlands und auf Kosten Russlands.“ (Zbigniew Brzensinski am 4. Juni 2009)
„Russlands Bodenschätze sind zu gewaltig, als dass sie den Russen allein gehören dürfen.“ (Madeleine Albright, US-Aussenministerin 1997-2001)
„Ziel der USA ist Russlands Spaltung und Zerfall.“ (Ben Hodges, ehemaliger Befehlshaber der US-Armee in Europa)
„Die USA müssen in jeder Region der Welt die militärische Vormachtstellung innehaben und den aufstrebenden regionalen Mächten entgegentreten müssen, die eines Tages die globale oder regionale Vorherrschaft der USA herausfordern könnten, vor allem Russland und China. Zu diesem Zweck sollte das US-Militär in Hunderten von Militärstützpunkten auf der ganzen Welt in Stellung gebracht werden und die USA sollten darauf vorbereitet sein, bei Bedarf Kriege nach Wahl zu führen. Die Vereinten Nationen sollen von den USA nur dann genutzt werden, wenn dies für ihre Zwecke nützlich ist.“ (Paul Wolfowitz, ehemaliger US-Unterstaatssekretär und persönlicher Berater von Präsident George W. Bush)
„Denken Sie daran, wir haben acht Jahre damit verbracht, diese Armee in der Ukraine zu dem einzigen Zweck aufzubauen, um Russland anzugreifen. Dafür wurde sie entwickelt. Deshalb haben die Russen sie angegriffen.“ (Douglas McGregor, ehemaliger US-Sicherheitsberater und pensionierter US-Colonel)
„Seit 2014 haben wir die Ukraine massiv mit Waffen versorgt. Das ist natürlich eine sehr bewusste, starke Provokation. Es war uns bewusst, uns in einen Bereich einzumischen, den jeder russische Führer als untragbar ansehen muss.“ (Jens Stoltenberg, ehemaliger NATO-Generalsekretär)
„Mit einem Bruchteil des amerikanischen Verteidigungsbudgets konnten wir die russische Armee erheblich beschädigen und degradieren. Und deshalb sollten wir damit auch weitermachen.“ (Jens Stoltenberg)
„Ich hätte nicht gedacht, das einmal sagen zu müssen: Aber wir werden Russland noch einmal so niederringen müssen, wie wir das im Kalten Krieg mit der Sowjetunion gemacht haben.“ (Sigmar Gabriel, ehemaliger Bundesvorsitzender der SPD und deutscher Vizekanzler)
„Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Wir müssen alles tun, damit die Ukraine in die Lage versetzt wird, nicht nur Ölraffinerien in Russland zu zerstören, sondern Ministerien, Kommandoposten, Gefechtsstände.“ (Roderich Kiesewetter, CDU-Politiker)
„Wir haben einen Krieg begonnen, wie ihn die Welt seit 60 Jahren nicht mehr gesehen hat.“ (Yevhen Karas, ukrainischer Ultranationalist)
„Wir müssen die Wahrheit sagen. Amerika steht nicht aus Nächstenliebe an der Seite der Ukraine, sondern weil es in unserem strategischen Interesse ist.“ (US-Vizepräsidentin Kamala Harris am 15. Juni 2024)
„Die USA werden ihre Söhne und Töchter in den Krieg senden müssen, so wie wir unsere Söhne und Töchter in den Krieg senden, und diese werden kämpfen und sterben müssen.“ (Wolodomyr Selenskyi, Präsident der Ukraine)
„Unsere Sanktionen werden die russische Wirtschaft ruinieren.“ (Analena Baerbock, deutsche Aussenministerin)
„Ich würde einen Atomschlag gegen Russland durchführen, auch wenn das Ergebnis eine totale Vernichtung wäre.“ (Liz Truss, britische Premierministerin 2022)
„Die Russen sind Schweine, Hunde, Verbrecher, Tiere, Unrat und Barbaren, die in der Hölle brennen sollen.“ (Serhij Zhadan, in seinem Buch „Himmel über Charkiw“, welches mit dem Friedenspreis 2022 des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde)
„Alles, was russisch ist, muss verschwinden. Die russische Sprache, die russische Kultur, die russische Geschichte. Alle, die meinen, sie hätten das Recht, in der Ukraine Russisch zu sprechen, müssen das Land verlassen.“ (Vlad Omelyan, ukrainischer Minister für Infrastruktur)
„Hat denn Europa jemals nicht feindselig auf uns Russen geblickt, kann es das überhaupt?“ (Fjodor Michailowitsch Dostojewski, russischer Schriftsteller, in „Tagebuch eines Schriftstellers“)
„Ich bin zutiefst beunruhigt über den drohenden Hunger in der Welt. Doch um Russland zu vernichten, müssen wir das ertragen.“ (Janet Yellen, US-Finanzministerin, 2021-2025)
„Russland wird immer ein Feind für uns bleiben.“ (Johann Wadephul, CDU-Politiker und Anwärter auf das deutsche Aussenministerium, am 30. April 2025)
„Kriege enden nur mit militärischer Erschöpfung.“ (Bundeskanzler Friedrich Merz am 15. Mai 2025)
„Das Ziel muss sein, Russland zu zerschlagen und in kleinere Länder aufzuspalten.“ (Kaja Kallas, EU-Vizepräsidentin)