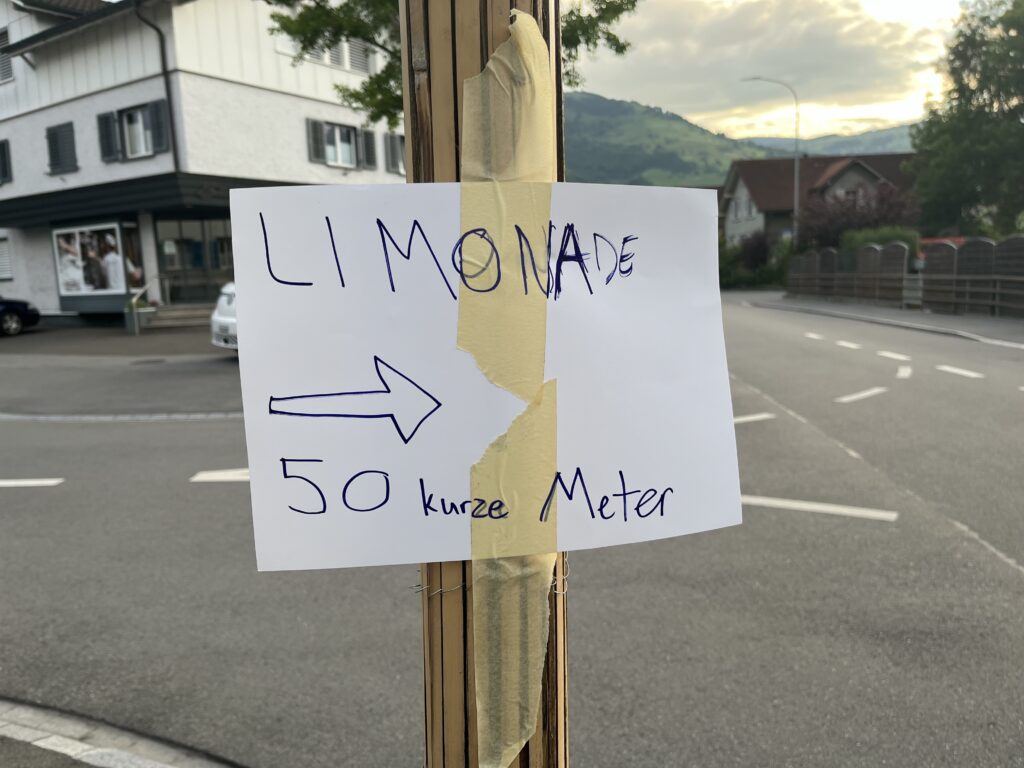Alles begann mit einem gestohlenen Schirm. Ich hatte ihn erst kürzlich gekauft und war richtig stolz darauf: So ein schöner, edel aussehender schwarzer Schirm mit einem Muster aus winzigen goldenen Würfeln und mit einem Griff aus echtem Holz. Vor dem Einkaufen im Supermarkt hatte ich ihn in den Schirmständer gestellt, doch nach dem Einkaufen war er spurlos verschwunden. Der erste Impuls: ärgerlich, einfach nur ärgerlich, der wunderschöne Schirm, einfach weg. Doch erstaunlicherweise war der Ärger schon kurz darauf verflogen, spurlos verschwunden wie der Schirm. Und ich sagte mir: Er ist ja nicht weg, es hat ihn bloss jemand anders. Und dieser andere ist jetzt vielleicht ebenso stolz auf den wunderschönen Schirm, wie ich zuvor auf ihn gewesen war. Und auf einmal war alles ganz leicht. Ich ging die fünf Minuten zum nächsten Schirmgeschäft, ein besonderes, nicht alltägliches Gefühl, so ohne Schirm durch den prasselnden Regen zu gehen. Zuerst dachte ich, ich würde genau den gleichen Schirm noch einmal kaufen. Doch dann sah ich ihn: Feuerrot, dazwischen, sanft ineinanderfliessend, orange Flächen, darüber ein Muster aus unterschiedlich langen, wellenartigen Strichen, zwischen ihnen kleine Vögel, als flögen sie zwischen Kontinenten hin und her. Es war Liebe auf den ersten Blick. Als ich ihn dann im Regen aufspannte und nach Hause ging, war alles wieder gut: Irgendwer besass jetzt einen wunderschönen schwarzen Schirm. Das kleine Schirmgeschäft mit der sympathischen Verkäuferin, bei dem ich mich, angesichts des gnadenlosen Konkurrenzkampfs mit dem Internet, sowieso schon lange gewundert habe, dass es nicht längst schon dichtmachen musste, hatte wieder ein paar Franken mehr in der Kasse. Und ich habe jetzt den schönsten Schirm, den ich jemals gehabt habe…
Als ich die Geschichte am nächsten Tag einer guten Freundin erzählte, sagte sie: Wunderbar, das wäre mir nicht in den Sinn gekommen, als mir kürzlich, ebenfalls beim Einkaufen, meine eben erst gekaufte Regenjacke gestohlen worden war. Aber ja, das könnte man versuchen: Irgendwie lässt sich vielleicht doch mit ein wenig Phantasie etwas Ärgerliches in etwas Erfreuliches verwandeln. Ich jedenfalls, sagte sie, habe jetzt gerade das Gefühl, in meinem Kopf sei eine alte Denkverbindung unterbrochen worden und eine neue entstanden. So, als wäre ein Schalter umgelegt worden.
Es ist einfach. Man kann es üben und jeden Tag ein bisschen etwas dazu lernen. Als etwa zwei Wochen später die Zeitung, die normalerweise etwa um halb zwölf kommt, um zwölf immer noch nicht in meinem Briefkasten lag, hätte ich mich auch wieder ärgern können. Doch im gleichen Augenblick sah ich vor meinem inneren Auge die Pöstlerin, wie sie wohl jetzt gerade irgendwo in der Stadt von Briefkasten zu Briefkasten hetzt. Vielleicht war ja heute besonders viel Post auszutragen. Oder vielleicht war jemand krankheitshalber ausgefallen. Und schon war das Mitleid mit der gestressten Pöstlerin ungleich viel grösser als der Ärger, dass ich meine Zeitung nun erst eine Stunde später würde lesen können. Als sie kurz darauf auftauchte und ganz offensichtlich ausser Atem war, erfüllte mich ihr freundliches Lächeln, das sie mir dennoch schenkte, mit umso grösserer Dankbarkeit. Und alles war gut.
Gemeinschaftliches, ganzheitliches, solidarisches, menschenverbindendes Denken scheint über Jahrzehnte immer mehr ins Hintertreffen geraten zu sein. Wenn die Leute etwas kaufen, reden sie immer vom „Preis-Leistungs-Verhältnis“, als wäre das eine in Stein gemeisselte, unumstössliche, nahezu religiöse Wahrheit. Dabei kann etwas doch nur dann gleichzeitig qualitativ so viel besser und gleichzeitig so viel billiger sein als etwas anderes, wenn irgendeine Form von Ausbeutung dahinter steckt, Ausbeutung auf Kosten der Natur, auf Kosten zukünftiger Lebensgrundlagen oder auf Kosten menschenunwürdiger Arbeitsbedingungen. Eine auf unersättliche Profitmaximierung und endloses Wachstum ausgerichtete Wirtschaft produziert so unsinnige Dinge wie künstliche Spielzeugtiere aus Stoff oder Plastik, die fast alles können, was richtige Tiere auch können, und verprasst hierfür Ressourcen, Wasser und Energie ohne jegliches Mass in einer Welt, in der gleichzeitig jeden Tag rund 150 echte Tiere und Pflanzen für immer aussterben. Aktionäre von Rüstungsfirmen scheffeln zu ihrem schon in unsäglichem Überfluss vorhandenen Geld weiteres Geld in noch grösserem Überfluss hinzu, einfach dadurch, dass Abertausende namenloser Menschen auf irgendwelchen fernen Schlachtfeldern ihr Leben opfern müssen oder für den Rest ihres Lebens verstümmelt bleiben. Flüchtlinge aus Ländern, die über Jahrhunderte ausgebeutet wurden und sich jetzt einen winzigen Teil des ihnen Geraubten wieder verzweifelt zurückzuholen versuchen, werden kriminalisiert und die, welche an all diesen Verbrechen Schuld sind, werden als Helden gefeiert. Alles ist zersplittert, alles ist von allem getrennt, alle globalen und historischen Zusammenhänge gekappt, alle Verbindungen zwischen Tätern und Opfern unsichtbar gemacht. Die Saat ist aufgegangen. Was die neoliberale Vordenkerin Margret Thatcher 1987 verkündete, nämlich, dass es keine Gesellschaften gäbe, sondern nur Individuen, ist tausendfach zur „Normalität“ geworden. Und nur ein radikales Umdenken, das Springen vom Denksystem des Egoismus in das Denksystem der Gemeinschaftlichkeit, kann uns die Augen öffnen für eine Zukunft, in der die Menschen wieder gelernt haben werden, dass es niemandem wirklich gut gehen kann, wenn es nicht allen anderen auch gut geht.
Letzten Dezember musste ich mich einer Hüftoperation unterziehen. In der ersten Nacht nach der Operation hatte ich so grosse Schmerzen, dass ich unmöglich schlafen konnte. Es wäre weit mehr als je Grund gewesen, mich aufzuregen, mich zu ärgern, nach stärkeren Schmerzmitteln zu rufen oder mich beim Pflegepersonal zu beschweren oder gar die Vermutung zu äussern, es könnte ja bei der Operation vielleicht etwas schiefgelaufen sein. In diesem Augenblick traten mir die Bilder aus dem Gazastreifen vor die Augen, die schmerzverzerrten Gesichter von fünf- oder sechsjährigen Kindern, denen ohne Narkose Arme oder Beine abgetrennt werden, Ärzte und Ärztinnen, die bis zur Erschöpfung Tag und Nacht ohne Schlaf zwischen auf dem nackten Boden liegenden schreienden Kindern hin- und herrennen, um sie wenigstens mit dem Allernötigsten zu versorgen, während Flugzeuge mit Bomben und Raketen über sie hinwegdonnern. Und ja, es ist wahr: In diesem Augenblick spürte ich keine Schmerzen mehr, fühlte mich nur unendlich privilegiert und unendlich traurig, dass zur gleichen Zeit andere Menschen so unsäglich leiden müssen, nur weil sie zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort geboren wurden. Und jetzt konnte ich nicht nur wegen meiner Schmerzen nicht mehr schlafen, sondern vor allem auch wegen dieser Traurigkeit. Ich nahm mein Handy hervor, klickte mich bei X ein und schrieb während etwa drei Stunden viele meiner wohl mitfühlendsten Tweets, die ich je geschrieben habe. Alle Müdigkeit war weg. Durch die Nacht hindurch fühlte ich mich mit den Kindern in Gaza und allen anderen weltweit leidenden Menschen zutiefst verbunden. Und ich wusste, diese Nacht würde ich nie, niemals vergessen.
Vor ein paar Tagen wurde mir, während ich zum Einkaufen in der Stadt war, die Peace-Fahne von meinem Haus abgerissen. Wieder hätte ich allen Grund gehabt, mich zu ärgern. Doch auch hier brauchte es nur einen kurzen Moment der Besinnung. Was könnte einen Menschen dazu bringen, eine Peace-Fahne von einem fremden Haus abzureissen, woher könnte ein solcher Akt offensichtlich blinder Wut kommen, was für eine Lebensgeschichte könnte dahinter stecken? Ich möchte es wissen. Ich habe am Briefkasten ein Plakat aufgehängt und einen Leserbrief an die Lokalzeitung geschickt, um die Person, die ja offensichtlich mit ihrer „Tat“ etwas sagen wollte, zu einem Kaffee einzuladen, um miteinander herauszufinden, ob Krieg unvermeidlich ist, eine Welt ohne Kriege denkbar wäre und was wir dafür oder dagegen tun könnten.
Vielleicht könnte man so etwas sogar als „Sozialismus“ bezeichnen. Nicht ein von oben verordnetes und aufgezwungenes Denksystem, sondern etwas, was von unten langsam wachsen müsste, aus dem Bewusstsein, dass alles mit allem zusammenhängt, dass alle für alle verantwortlich sind, dass alles allen gehört, dass alle von allen etwas lernen können. Eigentlich müssten wir nur in die Natur schauen und von ihr lernen. Unter der Erdoberfläche, unsichtbar, sind alle Bäume mit allen anderen Bäumen verbunden, durch Pilzgeflechte unvorstellbaren Ausmasses, über welche gegenseitig beständig Nahrung ausgetauscht wird und unaufhörlich den Schwächeren von den Stärkeren geholfen wird in einer Art und Weise, die man im tiefsten Sinne als „Liebe“ bezeichnen könnte. Bevor wir Menschen uns als „Krone der Schöpfung“ bezeichnen dürfen, gibt es zweifellos noch viel, noch sehr viel zu tun. Aber es ist möglich, und an jedem einzelnen Tag können wir uns auf diesem Weg ein bisschen weiter in die Zukunft bewegen…
Lieber Herr Sutter, vielen Dank für Ihre wunderschöne Geschichte, Sie beschreiben, wie das Gehirn den natürlichen empathischen Zustand lernen kann. Babys kommen alle mit diesem Urzustand auf die Welt, später lernen sie feindselig zu sein. Mögen viele von Ihrer Geschichte lernen. (Dr. Gertrud Müller, Psychoonkologin)